Die richtigen Fragen stellen: Wie verändert „KI“ das Gesundheitswesen?
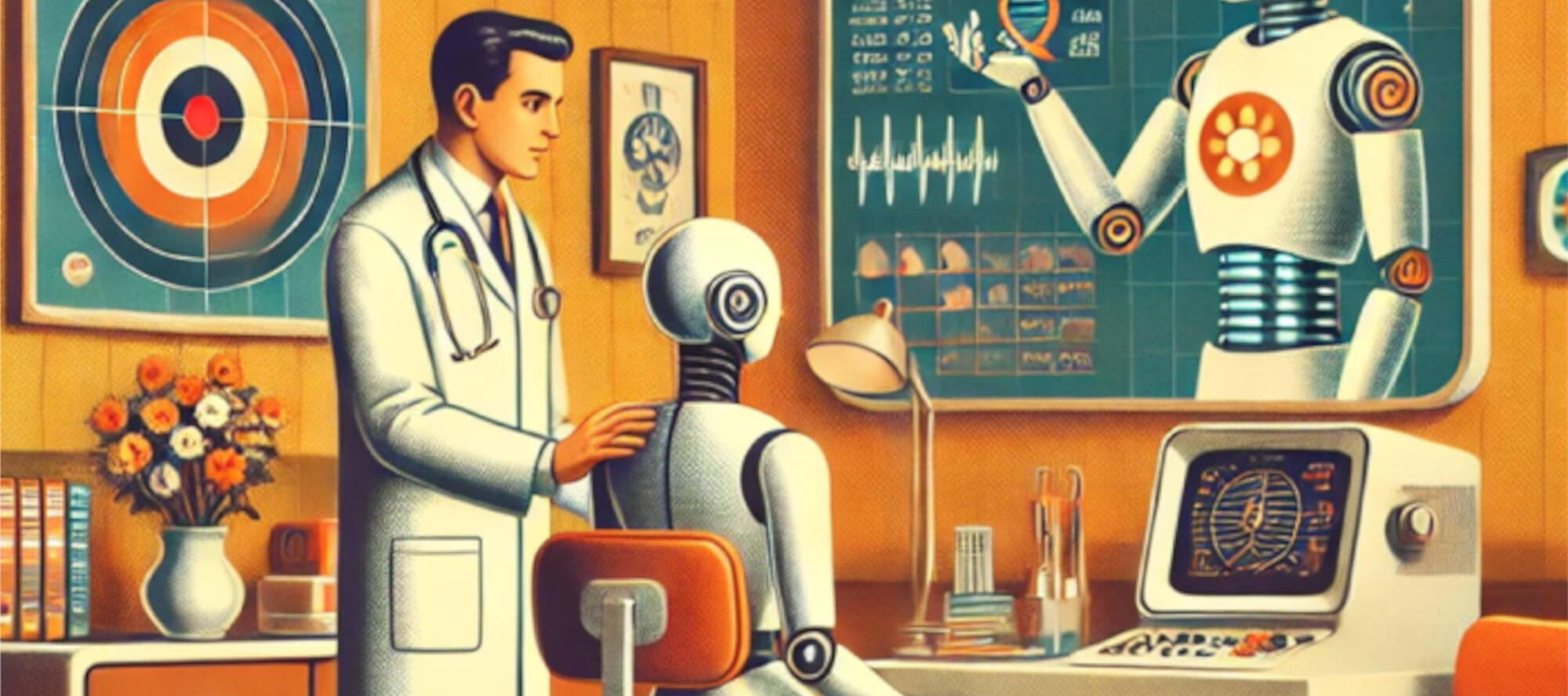
Das Bundesgesundheitsministerium hat Anfang Februar 2026 ein Update zur Digitalisierungsstrategie des Gesundheitswesens vorgelegt. Jetzt gilt es, die richtigen Fragen zu stellen.
Groß sind die Versprechungen, die mit „Künstlicher Intelligenz“ („KI“) und Digitalisierung einhergehen. Das ist auch im „Update der Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege“ nicht anders, das am 11. Februar von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken vorgestellt wurde: Ein „gesünderes und längeres Leben für alle“ soll Digitalisierung ermöglichen durch eine medizinische Versorgung und Pflege, die „besser und effizienter“ werden, heißt es darin zum Beispiel.
Die Strategie war ursprünglich 2023 vom damaligen Minister Karl Lauterbach vorgelegt worden. Der Aufbau des Europäischen Gesundheitsdatenraums (EHDS), neue Erwartungen im Bereich der „Künstlichen Intelligenz“ sowie der Plan eines neuen Systems für die Erstversorgung machten das nun vorgelegte Update notwendig.
Die wichtigsten Elemente: Die ePA soll zur zentralen Anwendung für Gesundheitsthemen ausgebaut werden, Digitalisierung der Schlüssel zu einem erfolgreichen Primärärzt*innensystem sein und „KI“ soll „sicher, flächendeckend und wirksam“ eingesetzt werden.
Digitalisierung und „KI“ werden das Gesundheitswesen fraglos verändern. Doch es ist wichtig, jetzt die richtigen Fragen zu stellen:
Wie weit hilft „KI“ dem Gesundheitswesen?
Während Digitalisierung und „KI“ durchaus das Potenzial haben, Prozesse im Gesundheitswesen zu vereinfachen und die Versorgung zu verbessern, kommt es auf eine gewissenhafte Abwägung bei der Umsetzung an.
Den großen Hoffnungen, mit denen der Einsatz von „KI“ derzeit verbunden ist, müssen wir realistisch begegnen.
Dabei dürfen wir vor allem nicht vernachlässigen, wie weitreichend die Auswirkungen auf Menschen in Gesundheitsberufen, auf Patient*innen und auf das Verhältnis zwischen ihnen sein können. Dazu braucht es mehr strategische Auseinandersetzung und Debatten.
Den großen Hoffnungen, mit denen der Einsatz von „KI“ derzeit verbunden ist, müssen wir realistisch begegnen: Weder wird „KI“ alle strukturellen Probleme im Gesundheitswesen wie Personalmangel oder Kostenexplosion lösen können, noch sind die großen Versprechungen medizinischer Spitzenleistungen und Effizienzgewinne bisher eingetreten – oder auch nur auf absehbare Zeit erwartbar.
Die technische Architektur der „KI“-Systeme gründet auf massenhaften Daten plus Stochastik, also der mathematischen „Kunst des Vermutens“. Das begrenzt diese Systeme dauerhaft: Es gibt keine Garantie dafür, dass Aussagen der „KI“ wahr und richtig sind. Anders als bei einem Algorithmus, der nach festen Regeln funktioniert und bei gleichen Bedingungen wiederholbare Ergebnisse liefert, ist diese Wiederholbarkeit bei „KI“ gerade nicht gewährleistet. Auch ist nicht nachvollziehbar, was genau den jeweiligen Antworten zugrunde liegt.
Welche Zwecke soll und kann Dokumentation erfüllen?
„KI“-gestützte Dokumentation soll in wenigen Jahren bei mehr als 70 Prozent der Einrichtungen zum Standard geworden sein, heißt es in der Strategie.
Sicherlich: Dokumentation ist oft lästig, aber sie kann auch dabei helfen, ein gemeinsames Verständnis zwischen Patient*in und Ärzt*in herzustellen oder zu überprüfen oder eine wichtige abschließende Reflexion über einen Fall darstellen.
Was bewirkt Automatisierung mit „KI“?
Selbst wenn eine Entlastung durch Automatisierung in diesem Fall naheliegt:
Schafft sie wirklich mehr qualitativ hochwertige Zeit für die Behandlung von Patient*innen oder wird sie am Ende Ausdruck einer noch stärker verdichteten Arbeitsrealität von Menschen in Gesundheitsberufen sein?
Das ist gerade angesichts des demografischen Wandels erwartbar, der in den nächsten Jahren viele ältere Patient*innen mit größeren Behandlungsbedarfen bringen wird, während zugleich viele Menschen in Gesundheitsberufen in Rente gehen. Weniger Ärzt*innen müssen also künftig mehr Patient*innen behandeln, wenn nicht gegengesteuert wird.
Dabei entscheidet eine gute Beziehung zwischen Ärzt*innen und Patient*innen über den Heilungsverlauf mit – auch bei körperlichen Erkrankungen. Doch dafür braucht es Zeit.
Wie wichtig ist uns digitale Souveränität?
Bei der Automatisierung der Dokumentation strebt die Ministerin ein hohes Tempo an. Mit Blick auf die bisher auf dem Markt dominierenden Anbieter könnte das dazu führen, dass bald regelhaft OpenAI, Google Gemini und Co. mit im Sprechzimmer sitzen. Die Abhängigkeit von den USA wächst bei verstärktem Einsatz der Dienste weiter.
Große Anbieter von Praxisverwaltungsystemen werben bereits mit „KI“-Tools zur Dokumentation und Automatisierung. Schaut man genauer in die Datenschutzbestimmungen, bestätigt sich die Vermutung:
Doctolib setzt Anthropic und Google setzt Gemini als „KI“ ein und hostet bei Amazon Web Services. Konkurrent Jameda begrüßt die neue Strategie als „wichtiges Signal für die Branche“ und verweist auf das eigene Dokumentationstool Noa Notes, das ebenfalls auf Amazon Web Services sowie Microsoft Azure setzt und auch OpenAI in der Datenschutzerklärung stehen hat.
VIA Health verspricht als „erster virtueller Assistent speziell für die Psychotherapie“ besten Datenschutz und weist gleichzeitig in der Datenschutzerklärung darauf hin, zur „Transkribierung der Audiospur sowie (…) Erstellung der Sitzungsprotokolle“ verschiedene Drittanbieter von „Large Language Models (LLMs)“ einzusetzen.
Das alles spiegelt die gegenwärtige Realität weiter Teile unserer digitalen Infrastruktur wider. Und gleichzeitig passt es nicht zusammen mit politischen Forderungen nach mehr digitaler Souveränität, die auch von der Bundesregierung selbst regelmäßig vorgetragen werden (z.B. in der Erklärung zum „Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität“ vom 18. November 2025).
Wie verändern Sprachmodelle die Beziehung zwischen Ärzt*innen und Patient*innen?
Auch zu „KI“-gestützten Systemen der medizinischen Ersteinschätzung müssen wir uns Gedanken machen. Künftig soll es auch so laufen: Symptome werden in ein Computersystem eingegeben, darauf folgt eine technische Einschätzung. Dieses Verfahren soll Teil des Erstversorgungssystems werden und so den Zugang ins Gesundheitswesen (mit) regeln. Noch ist nicht klar, ob regelbasierte Algorithmen oder „KI“ die technische Grundlage dafür bilden werden.
Öffnen wir mit digitalen Angeboten neue Wege für Patient*innen? Oder verlieren wir etwas, wenn wir uns mit standardisierten digitalen Ersteinschätzungen begrenzen?
Kurz vorm Besuch in der Praxis die Symptome online eingeben und sich gegebenenfalls aufgrund besserer Steuerung Wartezeit sparen, kann eine gute Idee sein.
Eines genaueren Blicks bedürfen allerdings Themen, die sensibler und oft schambesetzt sind: Einfühlsam und ohne Vorurteile über Sexualität zu reden, ist oft schwierig. So sprechen viele Patient*innen das Symptom einer Geschlechtskrankheit erst ganz am Ende der Sprechstunde an oder eine psychische Belastungssituation wird erst im Gespräch selbst deutlich.
Öffnen wir mit digitalen Angeboten neue Wege für Patient*innen? Oder verlieren wir etwas, wenn wir uns mit standardisierten digitalen Ersteinschätzungen begrenzen?
Und wie entstehen geschützte Räume für sensible Themen wie Sexualität, Geschlechtskrankheiten, Substanzkonsum oder psychische Störungen, wenn ein Tool im Raum steht, das alles Gesagte mitschneidet?
Wie gut sind Sprachmodelle als Gesundheitsassistenzen wirklich?
„KI“ soll zur ständigen Begleiterin für Patient*innen werden und perspektivisch „individualisierte Gesundheitsempfehlungen“ geben, heißt es in der Strategie weiter. Man möchte damit die Eigenverantwortung stärken.
Dabei hat gerade erst wieder eine in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Nature“ veröffentlichte Studie gezeigt, dass „KI“-Systeme faktisch daran scheitern, richtige Ergebnisse hervorzubringen, sobald man sich von theoretischem Lehrbuchwissen verabschiedet und reale Patient*innen auf sie loslässt (ein Bericht zur Studie findet sich bei heise.de).
Hinzu kommt: Bei Sprachmodellen (der Grundlage von „KI“), werden die Eingaben nicht über Standardfragen geleitet, sondern das Verfahren hängt stark von den Eingaben der User*innen ab. Davon hängen dann auch die Ergebnisse ab.
Wie gut ChatGPT und Co. reagieren, lässt sich damit auch nicht verlässlich für alle Anwendungsfälle überprüfen, weil die Anzahl möglicher Nutzer*inneneingaben unbegrenzt ist. Die Erwartung an Verlässlichkeit von Software-Programmen, die sich aus Zeiten regelbasierter Programmierung speist, ist bei auf Stochastik gründenden Ansätzen nicht haltbar – denn da sind immer Wahrscheinlichkeiten und sogar Zufall mit im Spiel.
Zwar gibt es mittlerweile Beispiele, in denen Menschen sagen: „KI“ hat mir geholfen, dass es mir gesundheitlich wieder besser geht. Gerade bei seltenen Erkrankungen, denen Ärzt*innen in ihrem Berufsalltag fast nie begegnen, wird den Sprachmodellen ein Potenzial zugesprochen.
Aber gleichzeitig gibt es besonders groteske Beispiele, in denen ChatGPT bei der Bewertung von Daten eines Gesundheitstrackers die Note „ungenügend“, also kurz vor Herzinfarkt, „geraten“ hat, während zwei Ärzte keine Anhaltspunkte für eine Erkrankung finden konnten (ein Bericht dazu findet sich hier).
Menschen handeln als Menschen und sind damit auch in der Interaktion mit Maschinen und bei der Interpretation „maschineller“ Antworten oft unberechenbar.
Das wiederum kann weitreichende Auswirkungen für Interaktionen zwischen Mensch und Mensch im Behandlungszimmer haben:
Fragen Ärzt*innen in der Sprechstunde künftig mit ab, ob Patient*innen bereits vorab mit „KI“ recherchiert haben? Was ist, wenn sich Empfehlungen von „KI“-Systemen und realen Mediziner*innen unterscheiden, wenn von der „KI“ vorgeschlagene Behandlungen nicht von den Kassen gedeckt werden oder Kapazitäten fehlen?
Wie bleibt das Gesundheitswesen menschlich?
Wenn sie gut gemacht sind, bieten Technologien die Chance, Medizin besser zu machen. Dafür müssen wir aber anfangen, uns die richtigen Fragen zu stellen – jenseits von Heilsversprechen und Technikgläubigkeit und im Wissen um den hochkomplexen Faktor Mensch, der im Übrigen auch kein „nerviges Beiwerk“ ist: Am Ende sollen es ja doch wir Menschen sein, die von den neuen Technologien profitieren – und nicht nur die Tech-Milliardäre, die sie mit den größten Versprechungen bewerben.
Offenlegung: Der Autor hat im letzten Jahr auf Einladung der Gematik am Fachforum „Technologien und Anwendungen“ für die Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie „Gemeinsam Digital“ teilgenommen.
Diesen Beitrag teilen




