„Die Verängstigung ist greifbar“

Stephan Jäkel ist systemischer Therapeut und arbeitet in der Schwulenberatung Berlin. Dort hat er häufig mit Männern zu tun, die ein HIV-positives Testergebnis zu verkraften haben, aber zum Beispiel auch mit Rentnern, die jahrelang in Therapiegruppen waren und denen er durch Denkanstöße zu einem neuen Leben verholfen hat. Häufiges Thema in seinen Beratungen ist „HIV und Strafrecht“.
Stephan, du hast einen schwulen Mann beraten, dessen Geschichte ich kurz skizziere: In alkoholisiertem Zustand lernte er einen gleichfalls angetrunkenen Mann kennen, woraus sich eine sexuelle Begegnung ergab. Am nächsten Morgen bemerkte er beiläufig, dass er HIV-positiv sei, aber erfolgreich behandelt und daher nicht infektiös.[1] Es war ohnehin nichts Infektionsrelevantes passiert. Trotzdem geriet der andere in Panik, und glaubte, man habe ihn willentlich infizieren wollen. Daraufhin unterzog er sich einer vorbeugenden Behandlung mit HIV-Medikamenten (PEP)[2]. Was macht so etwas mit den Menschen?
Gericht und Staatsanwaltschaft behandeln ihn als verantwortungslosen Straftäter
Glücklicherweise hatte der HIV-positive Mann schon vorher Zugang zu Selbsthilfe und Beratung und war nicht ganz so verängstigt. Er war sich sicher, er habe sich den Gepflogenheiten der Szene entsprechend angemessen und verantwortlich verhalten. Trotzdem vor Gericht zu kommen, hat ihn nachhaltig verunsichert. In der Beratung ging es zunächst darum, seine psychischen Ressourcen zu stärken, damit er das Strafverfahren gesund übersteht.
In erster Instanz behandelten ihn das Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft als verantwortungslosen und völlig uneinsichtigen Straftäter. Das ist schwer zu ertragen. Auch als gestandener und reflektierter Mensch, der weiß, dass das Strafrecht nicht das richtige Mittel ist, solche Konflikte zu lösen, führen die Verfahren zu großer Verängstigung. Man sieht sich plötzlich völlig schutzlos Vorwürfen ausgesetzt, nur weil der andere Beteiligte mit überzogenen Ängsten und dem Bedürfnis nach Bestrafung reagiert. Diese Ängste wurden noch verstärkt, weil ein Arzt eine an sich überflüssige PEP verordnete, statt ein gründliches Beratungsgespräch mit Risikoanalyse zu führen. Erschwerend kam hinzu, dass die Staatsanwaltschaft und das Gericht auf der Basis völlig falscher Vorstellungen zur HIV-Übertragung diskutierten. Eine ärztliche Entscheidung, die allen offiziellen Leitlinien zur PEP widersprach, hatte die Sachkenntnis der Juristen getrübt.

Wie wirken solche Verfahren über den Einzelfall hinaus?
Wenn Strafverfahren wegen einer möglichen HIV-Übertragung beim Sex in den Medien landen, wirkt sich das bei den Männern, die in die Schwulenberatung kommen, deutlich aus. Die Verängstigung ist greifbar. Für manchen stellt sich die Frage, wie er angesichts solcher Strafrechtsfälle überhaupt noch offen mit seiner Infektion umgehen kann. Hätte im eben besprochenen Fall der Mann einfach den Mund gehalten, wäre ihm nichts passiert. Eine HIV-Infektion war ohnehin ausgeschlossen, sodass er sich trotz Schweigens verantwortlich verhalten hätte. Solche Fälle fördern in der Community die Haltung: „Jetzt sag ich erst recht nichts mehr, sonst muss ich damit rechnen, beim nächsten Beziehungskonflikt vor dem Strafrichter zu landen.“
Das macht es natürlich schwierig, Begegnungen aus der Vergangenheit aufzuarbeiten.
Das ist nur ein Aspekt. Selbst wenn man mit seiner Vergangenheit aufräumt, schließt das nicht aus, dass in Zukunft neue Probleme auftauchen. Ausgangpunkt sind hier immer die völlig unterschiedlichen Risikobewertungen der Beteiligten. Da reicht es schon, sich nicht ganz so zu verhalten, wie der andere es erwartet. Überzogene Ängste sind immer noch ein sehr verbreitetes Phänomen und Auslöser für so manches Verfahren. HIV-Infizierte fühlen sich dadurch bedroht und erpressbar. Man kann nicht darauf vertrauen, dass die Justiz solche Lebenssachverhalte angemessen bewertet. Das Strafrecht hat doch nur bei Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung eine Berechtigung. Es ist weder ein Mittel der Prävention, auch wenn manche Juristen das fälschlicherweise so sehen, noch ist es ein Mittel, Offenheit und Ehrlichkeit im Beziehungsleben zu erzwingen.
Erwachsene Beteiligte wissen um die Gefahren
Strafrechtlich ist derjenige auf der sicheren Seite, der den Partner vorher informiert hat?
Aber das hängt doch von den Gepflogenheiten des Ortes, der Situation und der Beteiligten ab. Wenn kein Risiko vorhanden ist, kann es doch auch keine Informationspflicht geben. Und wenn nicht darüber geredet wird, wissen erwachsene Beteiligte trotzdem um die Gefahren, die in jeder sexuellen Begegnung lauern können.
Wurde das Thema Verantwortung in der Community und in den Aidshilfen zu lange auf einer falschen Ebene diskutiert?
Das spielt mit rein. Dass jeder für sein Verhalten verantwortlich ist, heißt nicht, dass der andere daraus irgendwelche Rechte ableiten könnte – das wurde bisher nicht wirklich deutlich. Die Eigenverantwortlichkeit anzuerkennen, ermöglicht es, an die Fürsorglichkeit zu appellieren, ohne daran gleich wieder juristische oder moralische Konsequenzen zu knüpfen. Denkt man in Täter-Opfer-Kategorien, dann ist doch der Infizierte meist beides. Selbst wenn man nur den Zeitraum zwischen Infektion und positivem Testergebnis betrachtet und davon ausgeht, dass eine Infektion nur auftritt, wenn man sich nicht durchgängig dem Safer Sex verpflichtet sieht, sondern eher den eigenen seelischen Bedürfnissen, dann ist jeder Infizierte auch potenzieller Täter.
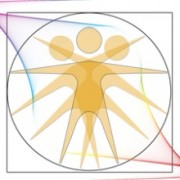
Die ganzen Diskussionen über „unterschiedliche Verantwortungen“ gehen am Kern der Sache vorbei. Sieht man HIV nicht als Folge eines einzigen „wrong fuck“, sondern mit dem sexuellen Lebensstil verknüpft, wird man von der Frage, wie sich der andere verhalten sollte, hin zur eigentlichen Frage gelenkt: Wie gehe ich mit mir selbst um? Dazu kann die Erkenntnis gehören, dass auch die sexuelle Biografie nicht zufällig ist, sondern von seelischen Bedürftigkeiten geprägt, und dass Gesundheit nicht allein „virenfrei“ bedeutet, sondern vielmehr, mit sich selbst im Einklang zu leben.
Das würde dann ja auch die Frage entschärfen, wie es heute bei aller Aufklärung über die Schutzmöglichkeiten noch möglich ist, sich zu infizieren.
Das ist einfach der Preis, den mancher für das Verfolgen seiner Glücksvorstellungen bezahlen muss. Sexualität sucht man sich doch nicht einfach aus. Seine Bedürfnisse lebenslang zu unterdrücken und dem Ziel „keine Infektion“ unterzuordnen, ist doch keine gesunde Lebensweise. Es ist gut, wenn Menschen ohne größere Verzichtsleistungen ihre Sexualität und ihre Schutzwünsche in Einklang bringen können. Aber jede Seele ist anders, und es steht niemandem zu, das zu bewerten oder gar Etiketten wie „Schuld“ oder „Versagen“ darauf zu kleben. Deshalb geht es in der Beratung eher darum, dass Menschen reflektieren, wie sie im sozialen und sexuellen Leben agieren, und dass man ihnen vielleicht weitere Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Schuld und Versagen sind dafür falsche Kategorien.
Kannst du Vergeltungswünsche verstehen?
Aus meinen Gruppen weiß ich, dass manche Positive es verwerflich finden, wenn etwa einer erzählt, er habe ungeschützten Sex mit jemandem gehabt, von dem er nicht wisse, ob er positiv ist.
Auch über Vergeltungsfantasien sollte man reden dürfen
Verteufelt man da nicht im anderen die eigenen unerfüllten oder auch gelebten und verdrängten Sehnsüchte?
Das mag sein. Im Übrigen ist es aber auch Ausdruck der überhaupt nicht hilfreichen Neigung, die eigenen Maßstäbe dem Rest der Welt aufzwingen zu wollen, und ein Hinweis darauf, dass die eigene Infektion als konflikthaft erlebt wird. Aus Einzel- und Gruppengesprächen kenne ich den Impuls, denjenigen anzeigen zu wollen, dem man die eigene Infektion zuschreibt. Aber ich habe in meiner Beratungstätigkeit keinen Fall erlebt, in dem das dann tatsächlich passiert wäre. Da mögen zwei Dinge reinspielen. Zum einen erlebt der infizierte schwule Mann, wie schwierig es sein kann, HIV in sexuellen Begegnungen so zu thematisieren, dass es die „Pirsch“ nicht völlig zerstört. Zum anderen führt eine Reflexion des Ganzen meist dazu, auch die eigenen Anteile an der Infektion zu erkennen. Und dann ist der Schluss zwingend, dass das Strafrecht der falsche Weg zu Aufarbeitung ist. Aber es kann wichtig sein, unter Positiven über solche Fantasien reden zu dürfen, um sich dann auch davon verabschieden zu können, statt den Weg einer Klage zu wählen.
Was würde passieren, wenn HIV als beschwerdearme chronische und „banale“ Erkrankung mit recht komfortablen Therapiemöglichkeiten gesehen würde?
Auf der individuellen medizinischen Ebene ist das ja häufig schon so. Aber das gesellschaftliche Stigma löst sich so leicht nicht auf. Da spielt die Homophobie mit rein. Es gibt einen harten Kern schwulenfeindlicher Menschen, die wir nicht erreichen werden. Da wirkt die Assoziation von Ausschweifung und Drogengebrauch mit rein. Das von außen kommende Stigma wird uns noch lange begleiten. An der eigenen inneren Bewertung können wir arbeiten, und da sind Veränderungen leichter möglich.
Einen weiteren Beitrag zum Thema Kriminalisierung von Menschen mit HIV finden Sie hier: „Da nahm das Drama seinen Lauf“
[1] Anmerkung der Redaktion: Eine erfolgreiche, stabile HIV-Therapie senkt die Viruslast im Blut sowie in den genitalen und rektalen Sekreten, wodurch auch die Infektiosität gesenkt wird. Die Wahrscheinlichkeit einer sexuellen HIV-Übertragung ist in diesem Fall um 96 % reduziert, wie eine im Mai 2011 veröffentlichte Studie mit dem Kürzel HPTN 052 belegt hat. Die Therapie schützt damit in etwa genauso effektiv wie Kondome, welche die HIV-Übertragungswahrscheinlichkeit um etwa 95 % verringern.
[2] Die Post-Expositions-Prophylaxe – kurz PEP – ist eine vierwöchige vorsorgliche Therapie mit HIV-Medikamenten. Sie soll verhindern, dass sich HIV im Körper „einnistet“ und es so zu einer chronischen HIV-Infektion kommt. Ob eine PEP zu empfehlen ist, muss der Arzt einschätzen; sinnvoll ist sie möglicherweise dann, wenn jemand ein erhöhtes Infektionsrisiko hatte (beispielsweise ungeschützten Vaginal- oder Analverkehr mit einem HIV-positiven Sexualpartner mit nachweisbarer oder unbekannt hoher Viruslast). Auch bei einer rechtzeitig begonnenen PEP – am besten innerhalb von zwei, möglichst innerhalb von 24 Stunden – ist allerdings nicht sicher, dass eine HIV-Infektion verhindert werden kann.
Diesen Beitrag teilen




