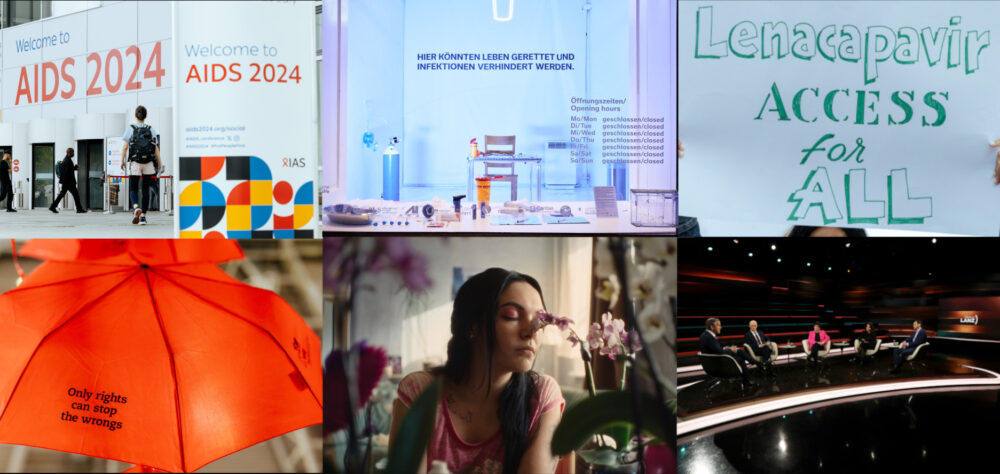Wie die Leichtigkeit des Seins in den HIV-Bereich einkehrte

Vier Jahrzehnte hat sich Christoph Mayr Menschen mit HIV gewidmet. Nun ist der Berliner Schwerpunktarzt in den Ruhestand gegangen. Warum die HIV-Behandlung eine Sonderstellung in der Medizin einnimmt, wie Pflegekräfte und Ärzteschaft durch die Aidskrise an ihre Grenzen gerieten, erklärt Mayr in einem persönlichen Rückblick.
Anfang Februar hat Dr. Christoph Mayr seinen Schreibtisch im Berliner Zentrum für Infektiologie (ZFI) geräumt. Mit ihm ist vermutlich einer der dienstältesten HIV-Expert*innen Deutschlands in den Ruhestand gegangen. Bereits während seines Studiums hatte er sich mit der damals ganz neuen Krankheit Aids beschäftigt. In der Aids-Ambulanz in München, der Tagesklinik des Berliner Auguste-Viktoria-Krankenhauses (AVK) und zuletzt in HIV-Schwerpunktpraxen hat er sich mit großem Engagement für HIV- und Aids-Patient*innen eingesetzt. Von 2008 bis 2014 stellte Mayr als Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte für Infektionskrankheiten und HIV-Medizin (dagnä) wichtige Weichen in der HIV-Behandlung. Durch zahllose Vorträge und Workshops quer durchs Land versorgte er Menschen mit HIV mit aktuellem medizinischem Wissen.
Dr. Christoph MayrIn den letzten Monaten ist mir so klar geworden, dass sich der Bereich HIV und Aids eklatant von anderen Fachgebieten unterscheidet, weil hier ein ganz besonderes, festes Bündnis zwischen dem Menschen mit HIV und dem Menschen, der ihn begleitet, besteht.
Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie zum ersten Mal von Aids gehört haben?
Sehr genau sogar. 1981, ich bereitete mich damals aufs Staatsexamen in der Krankenpflege vor, las ich in der „Süddeutschen Zeitung“ unter „Nachrichten aus aller Welt“ die verknappte Form dessen, was der „Morbidity and Mortality Weekly Report“ der US-Gesundheitsbehörden kurz davor berichtet hatte. Nämlich eine ungewöhnliche Häufung von seltenen Lungenentzündungen und Hauttumoren bei jungen schwulen Männern. Ich hatte diese Nachricht mit einem mulmigen Bauchgefühl zur Kenntnis genommen. Bald schon wurden dann immer mehr Fälle dieser damals seltenen Erkrankungen bekannt.
Das seltsame medizinische Phänomen, das damals zunächst als „Gay-Related Immune Deficiency“ bezeichnet wurde, war 1981 lediglich in den USA registriert worden. Wann haben Sie erstmals einen Aids-Fall in Deutschland erlebt?
Nach meiner Krankenpflegeausbildung hatte ich in Regensburg mit einem Medizinstudium begonnen und während einer Famulatur 1984 in München in der hämato-onkologischen Abteilung des Schwabinger Krankenhauses den jungen Assistenzarzt Hans Jäger kennengelernt. Der war gerade aus New York zurückgekommen, wo er am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York gearbeitet hatte und dort mit Aids konfrontiert wurde. In München hat er die ersten Patient*innen behandelt. Bei mir reifte damals schon die Idee, meine Doktorarbeit über Aids zu schreiben. Und tatsächlich gelang es mir nach meinem zweiten Staatsexamen 1986, nach München zurückzukehren und als Doktorand in der HIV-Ambulanz mitzuarbeiten, die Jäger aufgebaut hatte.
Was war das Thema Ihrer Dissertation?
Der vollständige Titel lautet: „Der natürliche Verlauf der HIV-Infektion. Eine seroepidemiologische Langzeitstudie an homo- und bisexuellen Männern unter Berücksichtigung biopsychosozialer Aspekte.“
Hans Jäger hatte bereits sehr früh mit einigen Aktivist*innen eine Arbeitsgruppe, den Vorläufer der Münchner Aids-Hilfe, gegründet. Über sie hat er Menschen mit HIV und Aids gewonnen, die ab 1984 an einer Langzeitstudie teilnahmen. Es ging damals darum, ganz grundlegende klinische Daten zum Krankheitsverlauf zu sammeln.
Eine Art kleine Münchner HIV-Kohorte?
Richtig. Von den 96 Personen, die an dieser Initialstudie dabei waren, habe ich dann 80 Menschen für meine Doktorarbeit über zwei Jahre hinweg in der Aids-Ambulanz begleitet. Wir mussten damals ja erst einmal virologische und immunologische Grundlagenforschung betreiben, um zu verstehen, wie und warum das Virus diese so unterschiedlichen Folgeerkrankungen auslöst. Ein Jahr zuvor war der HIV-Nachweistest zugelassen worden, man wusste inzwischen mehr über die Übertragungswege, aber noch sehr wenig über den Krankheitsverlauf.
Wer unter den Mediziner*innen hat sich damals für diese immer noch sehr neue, zudem dämonisierte Krankheit interessiert?
Ich denke, es war kein Zufall, dass sich sowohl auf wissenschaftlicher Seite wie auch im klinischen Bereich viele schwule Männer um Aids und an Aids Erkrankte kümmerten. Ich kann mich noch gut an meinen allerersten internationalen Aids-Kongress in Paris im Juni 1986 erinnern. Die Dominanz schwuler Männer unter den Virolog*innen wie unter den Ärzt*innen war augenfällig. Und es war kein Geheimnis, dass viele Mediziner mit dieser Krankheit schlicht nichts zu tun haben wollten. Als ich Ende der 1980er Jahre nach Berlin kam, hatten wir arge Not, niedergelassene Fachärzt*innen, die wir für die Mitbehandlung der Menschen mit HIV in unserem Versorgungssystem benötigten, mit ins Boot zu holen.
Hatten Sie in diesen frühen Jahren der Aidskrise Angst, sich selbst mit HIV zu infizieren?
Ich gehöre durchaus zu jener Generation, die sich hätten anstecken können, bevor die Gefahr überhaupt bekannt war. Denn mein schwules Coming-out lag vor dem Erscheinen dieses kleinen Artikels in der Süddeutschen Zeitung. Als Mediziner wusste ich bestens darüber Bescheid, was die Infektionswege sind – und was genau nicht. Als 1990 ein ZDF-Team in meiner Praxis drehte, weil sie für eine Reportage einen meiner Patient*innen porträtierte, strich ich ihm ganz selbstverständlich ohne Handschuhe über seine Kaposi-Sarkome. Mir wurde erst nach der Ausstrahlung bewusst, wie wichtig es war, dass diese beiläufige Geste im Fernsehen gezeigt wurde. Kolleg*innen hatten sich bei mir dafür bedankt, weil ich dadurch ganz beiläufig deutlich gemacht hätte, dass durch eine Berührung HIV eben nicht übertragen werden kann.
Dr. Christoph MayrAls 1990 ein ZDF-Team in meiner Praxis drehte, weil sie für eine Reportage einen meiner Patient*innen porträtierte, strich ich ihm ganz selbstverständlich ohne Handschuhe über seine Kaposi-Sarkome. Mir wurde erst nach der Ausstrahlung bewusst, wie wichtig es war, dass diese beiläufige Geste im Fernsehen gezeigt wurde.
In meiner beruflichen Vita gab es lediglich einen einzigen Moment, bei dem mir Schweißperlen auf der Stirn standen. Ich arbeitete damals in der AVK-Tagesklinik und wir führten bei einem HIV-Patienten ambulant eine Knochenmarkspunktion durch. Als ich die Nadel mit Knochenmark herauszog, rutsche ich ab und die Nadel steckte tief in meinem Handballen. Es ist alles gutgegangen, aber mir war klar, wie knapp ich einer Infektion entgangen war.
In den 1980er Jahren bestand HIV-Medizin im Wesentlichen darin, die durch Aids ausgelösten opportunistischen Infektionen zu behandeln. Es war aber meist eine Frage der Zeit, bis die Patient*innen die nächste Erkrankung traf.
Eine Pneumocystis-Jirovecii-Pneumonie konnten wir glücklicherweise schon in den 1980er Jahren sehr gut behandeln, gleichzeitig wussten wir: Solange wir die grundsätzliche Immunschwäche nicht behandeln können, erleben wir einen Drehtüreffekt. Wir werden diese Patient*innen immer wieder sehen, im Grunde bis zu ihrem Tod. Als ich 1989 nach West-Berlin ging, habe ich in der HIV-Schwerpunktpraxis des damaligen Kollegen Gerd Bauer gearbeitet und zweieinhalb Jahre Menschen mit HIV ambulant betreut. Stationär aufgenommen wurden Patient*innen eigentlich nur bei sehr akuten Fällen, etwa bei Luftnot infolge einer Lungenentzündung. Transfusionen, Infusionen – all das wurde vielfach zuhause gemacht; das wäre in den Kliniken gar nicht zu schaffen gewesen.
Ich habe die Stadt damals im Auto und mit der Straßenkarte auf den Knien kennengelernt, GPS und Navigator gab es ja noch nicht. In dieser Zeit habe ich über 100 Leichenschauscheine ausgefüllt.
Wie haben die Ärzt*innen und das Pflegepersonal das damals verkraftet?
Im Schwabinger Krankenhaus hatten sich die Pflegekräfte ganz gezielt für die Aids-Ambulanz beworben. Doch dort, wie auch später im Berliner Auguste-Viktoria-Krankenhaus, habe ich Kolleg*innen erlebt, die den HIV-Bereich irgendwann bewusst verlassen haben. Pfleger*innen, die gesagt haben: „Ich möchte ganz bewusst in einem anderen Fachgebiet arbeiten. Meine Batterie ist leer, ich kann das Sterben nicht mehr ertragen.“ Es gab aber auch Pflegerinnen, die sich auf andere Stationen versetzen ließen, weil ihnen ihre Männer gedroht hatten, nicht mehr mit ihnen schlafen zu wollen, solange sie weiterhin HIV-Patient*innen versorgen.
Das waren aber Einzelfälle. Das lag sicherlich daran, dass die Pfleger*innen, Ärzt*innen, Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen ein verschworener Haufen waren und wir uns gegenseitig gestützt haben, wenn wir an den Rand unserer Kräfte gelangten. Weil der langanhaltende medizinische Erfolg bis Mitte der 1990er Jahre fehlte, war es eine Herausforderung und selbstverständlich auf Dauer sehr ernüchternd und frustrierend, in diesem Bereich zu arbeiten. Zu dieser Zeit ging es in unserer Arbeit vor allem um den ärztlichen und pflegerischen Beistand. Das aber ist im besten Sinne genau das, was der hippokratische Eid abverlangt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir erst 1987 ein Medikament bekamen, das originär gegen HIV zielen konnte.
Azidothymidin, kurz AZT, das unter dem Namen Retrovir in den Handel kam.
Zu Retrovir gibt es rückblickend drei Dinge zu sagen. Erstens: Es war ursprünglich nicht zur Behandlung von HIV gedacht, sondern von onkologischen Erkrankungen. Das hatte jemand aus der Schublade geholt und sich gedacht: Da wir im Moment nichts anderes haben, versuchen wir es mal damit.
Zweitens: Weil das Medikament viel zu hoch dosiert eingesetzt wurde, kam es zu schweren Nebenwirkungen wie der Retrovir-bedingten Blutarmut und sogar zu Todesfällen.
Und drittens: Das Virus entwickelte sehr schnell eine Resistenz gegen AZT, die Wirkung hielt also nicht lange an.
Wann gab es den ersten wirklichen Lichtblick in der Forschung?
Für mich waren die Jahre 1995/96 entscheidende Jahre. Zum einen war es nun möglich, die Viruslast zu bestimmen. Bis dahin haben wir uns neben den Helferzellen nur an klinischen Gesichtspunkten orientiert, also dem sichtbaren Krankheitszustand. Zum anderen standen uns die ersten Proteaseinhibitoren zur Verfügung, die letztlich zu dem führten, was wir auch heute noch Kombinationstherapie nennen.
Die entscheidende Studie zur Wirksamkeit der antiretroviralen Therapie wurde 1996 beim Welt-Aids-Kongress in Vancouver vorgestellt. Sie waren damals selbst vor Ort. War allen Teilnehmenden gleich klar, was das für die HIV-Medizin bedeuten wird?
Es waren ja zuvor schon Teilstudien bekannt geworden; wir wussten also, was auf uns zukommt. Aber man konnte in Vancouver das Aufatmen der HIV-Behandler*innen förmlich spüren. Nach all den vielen experimentellen Medikamenten, die sich dann doch als eher wirkungslos erwiesen hatten, ging endlich etwas nach vorn, und zwar fundamental. Zum ersten Mal kamen wir nicht mit leeren Händen zu unseren Patient*innen nach Hause.
Wollten dann alle gleich auf die ART wechseln oder mussten die niedergelassene Ärzt*innen bei ihren Patient*innen erst Überzeugungsarbeit leisten?
Anfangs war es in der Tat nicht immer einfach, die Medikamente an die Frau und den Mann zu bringen, eben weil sich Retrovir als sehr toxisch herausgestellt hatte. Die Dosis wurde dann zwar gesenkt, aber viele HIV-Patient*innen waren verunsichert. Auf der einen Seite stand die Krankheit, die unbehandelt offensichtlich zum Tode führt, und auf der anderen Seite waren die Medikamente, die offensichtlich deutliche Nebenwirkungen haben und den Körper auch schädigen können. Aber auch wir Ärzt*innen waren verunsichert. Natürlich waren wir froh um jede Substanz, die auf den Markt kam. Und gleichzeitig haben wir angefangen, Studienprojekte auch selbst zu initiieren. Nach einiger Zeit war aber klar, dass man eine HIV-Infektion nur durch den Einsatz antiretroviraler Substanzen überleben kann, beziehungsweise nur so mit dieser Infektion leben kann. Und das gilt bis heute.
Dr. Christoph MayrAnfangs war es in der Tat nicht immer einfach, die Medikamente an die Frau und den Mann zu bringen, eben weil sich Retrovir als sehr toxisch herausgestellt hatte. Die Dosis wurde dann zwar gesenkt, aber viele HIV-Patient*innen waren verunsichert.
Die Kombinationstherapie konnte dann bereits wenige Monate nach der Konferenz auch in Deutschland regulär eingesetzt werden.
Wir haben sehr schnell all das bei unseren Patient*innen auch sehen können, was John W. Mellors bei seiner Studienpräsentation in Vancouver angekündigt hatte: Durch die antiretrovirale Therapie wird die Virusvermehrung im Körper gestoppt, infolgedessen sinkt die Viruslast und die Zahl der Helferzellen steigt wieder an. Und nicht zuletzt zeigte sich die Wirkung darin, dass die Leute wieder an Gewicht zunahmen, die tastbar deutlich vergrößerten Lymphknoten kleiner und opportunistische Infektionen seltener wurden oder sogar gänzlich ausblieben. Die verschiedenen Medikamente, die in der Kombinationstherapie eingesetzt wurden, waren mit der Zeit immer besser verträglich und wirkungsvoller.
2000 kam dann der Proteaseinhibitor Lopinavir mit dem Handelsnamen Kaletra auf den Markt. Es gibt einige Patient*innen von mir, die heute noch sagen: Kaletra hat mir das Leben gerettet. Das Medikament war so gut verträglich und wirkte so stark, dass sie es bis heute als zentralen Game Changer in ihrem Leben betrachten.
Durch die antiretrovirale Therapie hatten nun plötzlich Menschen eine Zukunft, die mit dem Leben bereits abgeschlossen hatten. Viele hatten die Ausbildung abbrechen müssen, eine Karriere gar nicht erst beginnen können und infolge dessen auch kaum Rentenansprüche. Sie standen nun vor der Frage, wie es für sie weitergehen soll.
Bis Mitte der 90er Jahre wurde die Berentung von Menschen mit HIV, die über eine längere Zeit krankgeschrieben waren, faktisch durchgewunken. Ein Schwerbehindertenausweis mit 100 Prozent Behinderungsgrad, inklusive „G“ für gehbehindert und „H“ für Hilflosigkeit, ging meist ohne jegliche Prüfung über den Tisch.
Für jene Menschen mit HIV, die durch die ART überlebt haben, war eine Rückkehr in den Beruf aber nicht immer so einfach. Das habe ich bei vielen Patient*innen aus dieser Zeit miterlebt. Dem einen oder der anderen ist die Rückkehr in den Beruf gut gelungen, anderen hingegen nicht. Sie hatten Veränderungen und Weiterentwicklungen in ihrem Beruf verpasst, andere waren durch die Therapie gezeichnet – denken wir nur an das Phänomen der Lipoatrophie [als sichtbarer Fettverteilungsstörung]. Oder aber das Immunsystem blieb auch unter Therapie geschwächt.
Die Virusvermehrung konnte ab 1996 dank der Therapie unterdrückt werden. Das bedeutete auch, dass Menschen mit HIV auf Lebenszeit HIV-Patient*innen sind und in engem Kontakt zu ihren HIV-Ärzt*innen bleiben. Was bedeutete dies für diese Beziehung? Bereits auf den Aids-Stationen in den 1980er Jahren war das ja etwas sehr Besonderes.
Sie sprechen damit einen ganz wichtigen Punkt an, der mich zum Ende meiner ärztlichen Karriere sehr beschäftigt hat. Seit ich im August 2025 beschlossen hatte, endgültig in den Altersruhestand zu gehen, habe ich mich nach und nach von meinen Patient*innenverabschiedet. Das war mir ein sehr großes Bedürfnis. Zuletzt habe ich weit über 500 Menschen mit HIV betreuen dürfen. Jede*r Einzelne bringt eine eigene Geschichte mit sich, viele habe ich 25 Jahre begleitet. Ein Patient, weit über 80, kam mit Gehhilfe, der mich sogar seit 36 Jahren aus meiner Zeit als Assistenzarzt kannte. Andere lernte ich als Klinikarzt im AVK in einer Akutphase mit Lymphomen, mit PCP, mit Toxoplasmose, mit Herpes-Enzephalitis kennen und sie wurden später Patient*innen in meiner Praxis.
Was will ich damit sagen? Es ist mir in den letzten Monaten so klar geworden, dass sich der Bereich HIV und Aids eklatant von anderen Fachgebieten unterscheidet, weil hier ein ganz besonderes, festes Bündnis zwischen dem Menschen mit HIV und dem Menschen, der ihn begleitet, besteht.
Sie haben über die Jahrzehnte Ihre Patient*innen sehr intensiv kennengelernt, sie durch Krisen begleitet und viele auch sterben sehen. Es dürfte schwer sein, diese Erfahrungen nach Feierabend in der Praxis oder Klinik zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen.
Das war in den Jahren der Aidskrise ganz sicherlich so. Dafür erleben wir HIV-Behandler*innen seit nunmehr gut zwei Jahrzehnten, dass unsere Patient*innen mit der Infektion die gleiche Lebenserwartung haben wie Menschen ohne HIV. Für Ärzt*innen wie mich, die ganz andere Zeiten durchlebt haben, ist es ein großes Geschenk, dass wir erleben durften, wie die Leichtigkeit des Seins in den HIV-Bereich eingekehrt ist, und wir nehmen das nicht als Selbstverständlichkeit.
Dr. Christoph MayrFür Ärzt*innen wie mich, die ganz andere Zeiten durchlebt haben, ist es ein großes Geschenk, dass wir erleben durften, wie die Leichtigkeit des Seins in den HIV-Bereich eingekehrt ist, und wir nehmen das nicht als Selbstverständlichkeit.
Ich hatte vor kurzem noch eine Situation, bei der ein langjähriger Patient wegen eines akuten Problems in die Sprechstunde gekommen war. Beim Gehen drehte er sich an der Tür noch einmal um und sagt: „Herr Mayr, mir fällt gerade auf: Wir haben heute gar nicht über unsere Helferzellen gesprochen.“ HIV ist für diese Patient*innen im Grunde kein Problem mehr. Menschen mit HIV sterben heute an den ganz normalen Alterserkrankungen: an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall, manche an Prostatakarzinom, andere an Lungenkrebs.
Sie hatten eingangs erzählt, welche Mediziner*innen sich vor 40 Jahren für das Feld HIV und Aids interessierten. Wie sieht es heute aus?
Der Berufsalltag eines HIV-Schwerpunktarztes hat sich deutlich verändert. Abgesehen von Late Presentern – Menschen, die erst zu einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium überhaupt ihre Diagnose erhalten – sind Aids-Erkrankungen heute eine große Seltenheit. Die eigentliche HIV-Behandlung und die PrEP-Vergabe sind zudem unkompliziert geworden.
Die dagnä, in deren Vorstand ich viele Jahre war, hat lange auf die Facharztbezeichnung Infektiologie hingearbeitet. Das hat die Aufmerksamkeit für diesen Bereich deutlich erhöht und bei jungen Mediziner*innen Interesse geweckt. Anders als früher sind es nicht mehr vornehmlich schwule Männer, die in diesen infektiologischen Bereich gehen.
Welche Entwicklungen in der HIV-Medizin werden Sie verpassen? Mit welchen Themen werden sich Ihre Kolleg*innen in den nächsten Jahren wahrscheinlich beschäftigen?
Ich bin bis zuletzt von meinen Patient*innen immer wieder gefragt worden, wann denn die Heilung von HIV komme. Und ich habe mich dabei ertappt zu sagen, dass ich – auch aufgrund meiner Erfahrungen der letzten vier Dekaden und trotz der Hoffnungen, die zwischendurch von bestimmten Koryphäen formuliert wurden – nicht glaube, dass ich noch eine Therapie erleben werde, die zu einer Ausheilung von HIV führt.
Ich glaube aber durchaus, dass alles noch verbesserungsfähig und -würdig ist, obwohl wir jetzt bereits bei Single-Tablet-Regimes und einer Zweimonatsspritze angekommen sind. Vielleicht kommt bald die Sechsmonatsspritze? Oder ein Implantat? Wer weiß.
Mehr zur HIV-Geschichte
Diesen Beitrag teilen