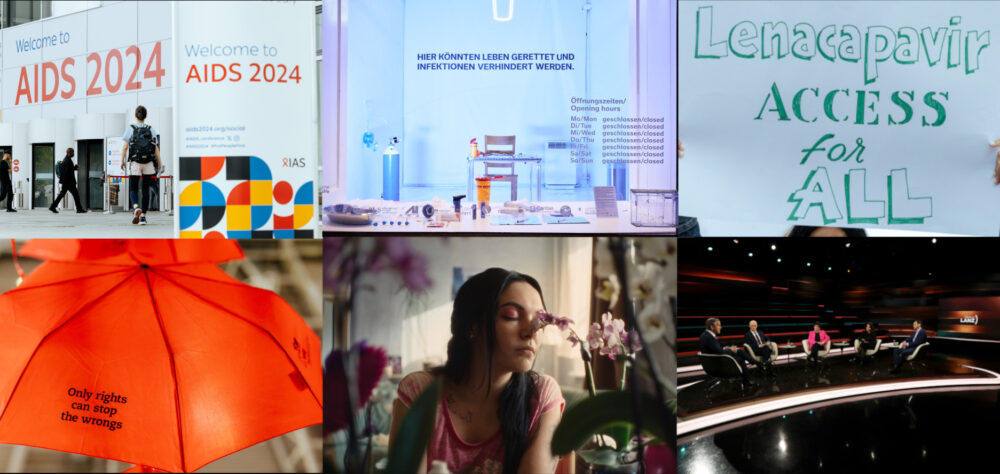Crack als Herausforderung für die Drogenhilfe

Mittlerweise hat Crack Einzug in die deutschen Großstädte gehalten. Diese Droge birgt ein enormes Suchtpotenzial und stellt die Drogenhilfe vor erhebliche Herausforderungen. Bewährte Hilfestrategien aus dem Umgang mit Opioiden sind hier nur eingeschränkt anwendbar. Mit innovativen Ansätzen geht man insbesondere in Zürich und Frankfurt neue Wege.
Im August-Bebel-Park am Drogenhilfezentrum Drob Inn versammeln sich täglich mehrere hundert Menschen in Gruppen. Viele wirken erschöpft; zahlreiche weisen offene Wunden auf, die dringend medizinische Versorgung erfordern würden. Die Crack-Pfeife geht immer wieder von Mund zu Mund – der Konsum findet mitten auf der Straße und im Blickfeld von Passant*innen und Reisenden statt. Oft ist zu beobachten, wie Konsumierende sich vor Erschöpfung auf den Gehweg zum Schlafen niederlegen. Einen festen Wohnsitz besitzen die wenigsten; das spärliche Hab und Gut tragen sie in Plastiktüten oder abgenutzten Rucksäcken bei sich.
Diese Szenerie folgt einer eigenen Dynamik: Wo der Alltag von Konsum und Beschaffung beherrscht wird, kommt es mit zunehmender Verzweiflung auch immer häufiger zu Auseinandersetzungen, zu kleinen und größeren Konflikten. Das, was in St. Georg rund um den Hamburger Hauptbahnhof zu beobachten ist, stellt keine Ausnahme dar. Durch die rasante Verbreitung von Crack scheinen sich in zahlreichen Städten offene Drogenszenen zu vergrößern oder neu zu entstehen.
Was macht Crack so besonders – und zugleich so gefährlich?
Noch vor wenigen Jahren war Kokain fast ausschließlich als Pulver auf dem Markt erhältlich. Die Umwandlung zu Crack erfolgte meist privat oder in Drogenkonsumräumen. Heute hingegen werden die Steine bereits konsumfertig und zu vergleichsweise niedrigen Preisen auf der Straße verkauft. Crack wird fast immer durch Rauchen konsumiert. Die Wirkung setzt innerhalb weniger Sekunden ein – intensiver, stärker, unmittelbarer als beim Kokainpulver –, lässt aber nach zehn bis fünfzehn Minuten bereits wieder nach.
Die kurze und intensive Wirkung löst den starken Wunsch nach erneutem Konsum aus. Dieses „Craving“ zwingt Konsumierende, rasch Geld zu beschaffen, um erneut konsumieren zu können – ein Kreislauf aus Konsum, Beschaffung und erneutem Konsum. Purer Stress also. Der niedrige Preis (ein „Stein“ kostet zwischen fünf und zehn Euro) verstärkt diese Dynamik zusätzlich. Viele Menschen konsumieren Crack bis zur völligen Erschöpfung und schlafen dann in der Öffentlichkeit ein.
Immer häufiger findet der Konsum daher direkt im öffentlichen Raum oder in der Nähe von Hilfseinrichtungen statt. Crack unterdrückt Hunger- und Durstgefühle, wodurch Betroffene stark abnehmen und dehydrieren. Die Folge sind Verwahrlosung und sichtbare Verelendung. Die „Handreichung zur Anpassung der Angebote in Aids- und Drogenhilfe für Crack-Konsument*innen“, die 2024 von der Deutschen Aidshilfe gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Drogenkonsumräume erstellt wurde, empfiehlt deshalb unter anderem, hochkalorische Nahrung und Getränke bereitzustellen sowie Ruhemöglichkeiten, sogenannte Tagesruhebetten, für mehrere Stunden anzubieten.
Was ist Crack?
Crack ist eine aufbereitete Form von Kokain, die eine extrem intensive, jedoch kurz anhaltende Wirkung entfaltet. Für die Herstellung werden Kokainhydrochlorid, Natron und Wasser vermengt und erhitzt. Dabei entsteht Kokainbase, welche nach der Entnahme zu gelblich-weißen Steinen erhärten. Beim Rauchen verursachen die Steine ein charakteristisches Knackgeräusch, das der Droge ihren Namen verleiht.
Die Substanz wird in kleinen Pfeifen geraucht und entfaltet ihre Wirkung schon innerhalb weniger Sekunden. Crack greift tief in die chemischen Prozesse des Gehirns ein und gilt als eine der Substanzen mit dem höchsten psychischen Abhängigkeitspotenzial. Der Konsum kann zu Angstzuständen, Depressionen sowie zu Herz- oder Atemstillstand führen – also bis hin zum Tod.
Barrierarme Drogenhilfe notwendig
DAH-Drogenreferent Dirk Schäffer weist auf eine weitere Besonderheit hin: „Dauerhafter Crackkonsum kann zu ausgeprägten psychischen Auffälligkeiten, etwa gesteigerter Reizbarkeit, gestörtem Realitätsbezug, aber auch zu Depressionen und Ängsten führen.“ Daher müsse das Fachpersonal im Suchthilfesystem gezielter auf diese massiven psychischen Belastungen vorbereitet werden und es gilt eine niedrigschwellige Form der psychiatrischen Versorgung zu etablieren.
„Wenn man sieht, in welchem körperlichen Zustand sich die Menschen befinden, dann weiß man unmittelbar, dass sie keine weiten Wege zurücklegen werden. Es ist entscheidend, sie dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten“, sagt Christine Tügel, Vorsitzende des Beratungszentrums Drob Inn am Hamburger Hauptbahnhof.
Schon einfache Hindernisse wie Treppen können für Abhängige kaum überwindbar sein. Hilfsangebote müssen daher möglichst barrierearm erreichbar sein. Selbst wenn es gelingt, Konsumierende in eine Einrichtung zu bringen, verlassen sie diese häufig bereits nach kurzer Zeit wieder – getrieben vom nächsten Konsumdruck. Für psychosoziale Unterstützung bleibt so meist kaum Gelegenheit.
Dirk Schäffer, DAH-Drogenreferent„Dauerhafter Crackkonsum kann zu ausgeprägten psychischen Auffälligkeiten, etwa gesteigerter Reizbarkeit, gestörtem Realitätsbezug, aber auch zu Depressionen und Ängsten führen.“
Zürich – ein europäisches Labor
Auch in der Schweiz – etwa in Genf, Lausanne, Basel, Zürich und Chur – haben sich offene Drogenszenen etabliert, in denen Crack zunehmend dominiert. Der sichtbare Konsum, die Notlagen der Betroffenen und die Sorgen um die öffentliche Sicherheit haben das Thema stärker in den Fokus von Politik und Medien gerückt.
Die Eidgenössische Suchtkommission fordert deshalb schnelle und niedrigschwellige Hilfsangebote. Crack-Abhängige lebten, so deren Vizepräsident Christian Schneider, in einem „Teufelskreis aus Konsum und Beschaffung“. Vorgeschlagen werden mobile Teams, die Suchterkrankte aufsuchen und sowohl medizinisch als auch psychotherapeutisch versorgen. Aufbauend auf den Erfahrungen mit der Diamorphin-Vergabe an Opiatabhängige kann sich Schneider auch eine kontrollierte Abgabe von Kokain an Schwerstabhängige vorstellen. Doch bislang fehlt es an Forschung und unter Fachleuten herrscht erhebliche Skepsis.
„Kokain ist deutlich schädlicher als Opiate, da es das Herz-Kreislauf-System beeinträchtigt und Psychosen auslösen kann“, warnt Marc Vogel, Chefarzt am Baseler Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen. Dennoch plädiert auch er für Modellprojekte, um praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Kokainkontrollabgabe zu sammeln.
Um umgehend auf die aktuelle Lage zu reagieren, hat das Schweizer Bundesamt für Gesundheit Runde Tische mit Städten und Kantonen initiiert. Zürich geht mit konkreten Maßnahmen voran: Rund drei Dutzend Sozialarbeiter*innen der Sozialambulanz sip züri sind täglich an Brennpunkten unterwegs. Sie sprechen Menschen auf der Straße an, führen sie in Hilfsangebote und wollen verhindern, dass sich die Zustände der 1990er Jahre wiederholen.
Damals wurde der Lettenpark am Zürcher Hauptbahnhof zum Symbol einer gescheiterten Drogenpolitik. Tausende Schwerstabhängige kampierten dort, der Park war der Öffentlichkeit faktisch entzogen, die Zahl der Drogentoten stieg dramatisch. Daraus entwickelte Zürich seine europaweit beachtete progressive Drogenpolitik.
Heute sind sowohl Fortschritte als auch neue Herausforderungen sichtbar. In den drei Züricher Konsumräumen wird Heroin kaum noch konsumiert, rund 80 Prozent der etwa 1.000 täglichen Besucher*innen nutzen Crack. Zutritt erhalten ausschließlich in Zürich gemeldete Personen. Vor Ort gibt es medizinische und soziale Beratung, Wasch- und Duschmöglichkeiten sowie eine Kleider- und Schuhbörse. In überwachten Injektions- und Inhalationsräumen konsumieren die Menschen ihre mitgebrachten Drogen.
Eine Besonderheit: Kleinstmengen dürfen innerhalb bestimmter Areale der Einrichtungen untereinander weitergegeben werden – der sogenannte „Mikrohandel“. Personen, die nicht als Nutzer*innen der Einrichtungen registriert sind oder nur mit bloßer Verkaufsabsicht in die Einrichtung kommen sind hingegen nicht zulässig. So verlagert sich der Handel von der Straße in einen geschützten Rahmen. Polizei und Hilfsangebote arbeiten dabei eng zusammen.
Nadeen Schuster, Zürcher Sozialdepartement„Das Ziel ist nicht, drogenabhängige Menschen aus dem Straßenbild zu verbannen, sondern den Konsum und Handel von Drogen aus dem öffentlichen Raum herauszuhalten.“
Weil es in den Einrichtungen auch Ruhebetten gibt, bleiben viele Klient*innen länger – und sind so besser erreichbar für Beratung und medizinische Angebote. Anders als in Deutschland wird in Zürichs Notschlafstellen Substanzkonsum toleriert.
Für Daniel Deimel, Professor für Gesundheitsförderung und Prävention an der Technischen Hochschule Nürnberg, ist das Züricher Modell ein Vorbild. Er fordert Entkriminalisierung und die Schaffung von Räumen, in denen Mikrohandel toleriert wird. Doch dafür müsste entweder in Deutschland das Betäubungsmittelgesetz geändert werden oder es gilt wie in der Schweiz eine Übereinkunft zwischen der Polizei, der Staatsanwaltschaft und den Betreiber*innen der Einrichtungen zu schaffen. Denn auch in der Schweiz sind der Handel, der Besitz und die Weitergabe von Drogen weiterhin verboten.
Die Rechtsverordnungen der Bundesländer verhindern bislang beispielsweise, dass Drogengebraucher*innen Konsumräume nutzen, um dort gemeinsam zu konsumieren. Wenn etwa ein Paar gemeinsam Crack nehmen möchte, müssen sie rein rechtlich an der Tür abgewiesen werden. Denn das Teilen einer illegalen Substanz ist nicht erlaubt, selbst wenn kein Geld fließt. Doch gerade Crack wird häufig in der Gruppe konsumiert, indem man die Pfeife herumgehen lässt. Der Konsum muss in diesem Fall dann also doch draußen, im öffentlichen Raum stattfinden.
Ein weiterer Punkt: Es müssten ausreichend Konsumplätze zur Verfügung stehen und deren Öffnungszeiten deutlich erweitert werden, sagt Deimel. Er hat die erste Befragung der offenen Drogenszene in Köln durchgeführt und in seiner Studie „Open Drug Scene Cologne – Survey“ auch den Crack-Konsum analysiert. Die Konsument*innen, so eine Erkenntnis, nehmen die Droge bis in die späten Abendstunden.
Frankfurt plant das erste Crack-Suchthilfezentrum
Vieles davon, was in Zürich anders gemacht oder von Expert*innen vorschlagen wird, findet sich im Konzept eines Crack-Suchthilfezentrums, das in Frankfurt (Main) entstehen soll. Dort ist Crack seit 2012 die am weitesten verbreitete illegale Droge im Bahnhofsviertel. Rund 3.000 Menschen nutzen die Drogenkonsumräume der Stadt, etwa 53 Prozent von ihnen rauchen Crack. Auf der Straße liegt der Anteil bei etwa 80 Prozent. Etwa 200 bis 250 Menschen halten sich mehr oder weniger dauerhaft in der Szene auf.
Die grüne Sozialdezernentin Elke Voitl betont: Es gehe nicht um einen Kurswechsel, sondern um die Fortschreibung der seit den 1980er Jahren verfolgten Linie, Drogenabhängige nicht als Kriminelle, sondern als Kranke zu sehen, denen man helfen möchte. Ein Gebäude in der Niddastraße, unweit des Bahnhofs, soll ab 2026 ein Crack-Suchthilfezentrum beherbergen. Geplant sind medizinische und psychiatrische Versorgung, Substitution, psychosoziale Beratung, Vermittlung in Hilfen – alles unter einem Dach. Ein Café soll Rückzugsort und Treffpunkt zugleich sein, Beschäftigungsangebote sollen Tagesstruktur und Halt geben. Duschen, Kleiderkammer, Notschlafplätze, Tagesruheplätze und ein eigener Bereich für Frauen sollen grundlegende Bedürfnisse erfüllen helfen.
Oliver Müller-Maar, Drogenreferent der Stadt Frankfurt„Entscheidend ist, dass Angebote unmittelbar da sind, wenn die Menschen offen dafür sind.“
Auch Konsumräume sind vorgesehen, dazu ein geschützter Innenhof, in dem Mikrohandel toleriert werden soll. Doch dafür braucht es noch rechtliche Sicherheit, damit Mitarbeitende und Nutzer*innen nicht kriminalisiert werden. Neben den rund 150 vorhandenen Notschlafbetten plant die Stadt zusätzlich Mikroapartments in verschiedenen Einrichtungen zu schaffen. Sie sollen obdachlosen Konsumierenden, deren Lebensmittelpunkt das Bahnhofsviertel ist, zeitweise eigenständiges Wohnen ermöglichen – begleitet von Sozialarbeiter*innen und medizinischem Personal.
Zudem will die Stadt Studien zur Substitution mit Cannabis, Off-Label-Medikamenten oder Kokain initiieren. Mit dem von Heino Stöver an der Frankfurt University of Applied Sciences über Jahrzehnten aufgebauten Arbeitsbereich Suchttherapie und Sozialmanagement stünde ein idealer Kooperationspartner zur Verfügung. Erste konkrete Forschungsprojekte sind sogar schon angedacht, beispielsweise eine wissenschaftliche Studie zu Cannabisblüten mit ausgewogenem THC- und CBD-Gehalt als mögliche Therapie bei Crack-Abhängigkeit.
Doch um solche Forschungsprojekte durchführen zu können, benötigt die Stadt die Unterstützung von Land und Bund, beispielsweise eine Genehmigung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Aber auch rechtliche Grundlagen müssten durch Gesetzesänderungen angepasst werden. Denn die gesetzliche Voraussetzung für die Substitution ist im Wesentlichen auf Opioid-Ersatzbehandlungen ausgerichtet.
Das Frankfurter Crack-Suchthilfezentrum könnte so zu einem beispielhaften Projekt werden, in dem auf gleich vielen verschiedenen Ebenen Strategien zum Umgang mit den Folgen des zunehmenden Crack-Konsums neu bzw. weiterentwickelt werden. Mitte November, so Oliver Müller-Maar vom Frankfurter Magistrat gegenüber der DAH, soll entschieden sein, wer Träger der Einrichtung wird und das Projekt letztlich in die Tat umsetzen soll. Eine der ersten Aufgaben wird sein, den Dialog mit den Anwohner*innen zu suchen. Denn viele fürchten durch das Suchthilfezentrum Belastungen für das Viertel. Die Eröffnung ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.
Diesen Beitrag teilen