Arzt und Patient auf Augenhöhe?
„Die Rechte der Patientinnen und Patienten werden gestärkt. Das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt wird damit weiter ausgebaut. Unser Leitbild ist der mündige Patient, der informiert und aufgeklärt wird und so dem Arzt auf Augenhöhe gegenübertreten kann.“
So äußerte sich Gesundheitsminister Daniel Bahr am 1. Februar in einer Pressemitteilung zur Verabschiedung des Patientenrechtegesetzes durch den Bundesrat. Das Gesetz, das am 26. Februar in Kraft getreten ist, bündelt im Wesentlichen die gängige Rechtsprechung aus einzelnen Richterentscheidungen und schon bestehende Rechtsansprüche, die bisher auf viele verschiedene Rechtsbücher verteilt waren. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Artikelgesetz, durch das andere Gesetze geändert werden – in diesem Fall vor allem das Bürgerliche Gesetzbuch und das fünfte Sozialgesetzbuch (siehe Infografiken).
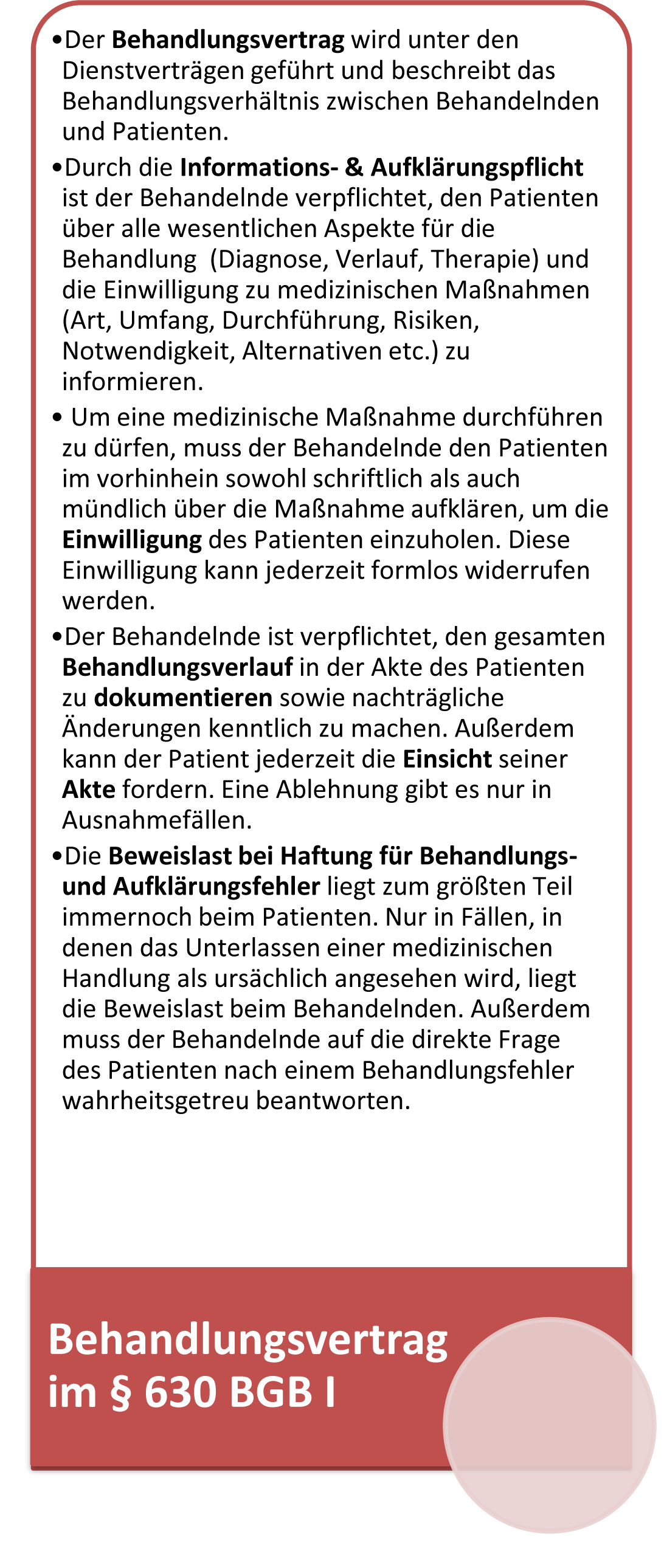
Die wichtigsten Regelungen betreffen die Beschleunigung von Anträgen, die Einsicht in die Patientenakte, die Informationspflicht des Arztes, die Beweislast bei Behandlungsfehlern und die Aufklärung über Zusatzkosten. Neu ist, dass diese Regelungen nicht nur für Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten gelten, sondern für alle, die medizinische Behandlungen durchführen. Dazu zählen z.B. Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Hebammen oder Masseure. Nur: Reicht die Festschreibung der gängigen Rechtspraxis schon für die „Augenhöhe“ aus?
„Noch Luft nach oben“
Verbraucherschutz-, Sozial- und Wohlfahrtsverbände halten mit ihrer Kritik an dem Gesetz ebenso wenig hinterm Berg wie der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung. „Viel Lärm um wenig Neues“ titelt die Verbraucherzentrale Hamburg, die die „kleinen Verbesserungen der Rechtslage für Patienten“ nicht als „den großen Wurf“ betrachtet; für den VdK „hält das Gesetz nicht, was sein Name verspricht“, und der GKV-Spitzenverband sieht „noch Luft nach oben“. Für ihn stimmt die Richtung, „aber die Umsetzung könnte noch besser sein“.
Zu den wesentlichen Kritikpunkten gehört die Regelung der Beweislast bei Behandlungsfehlern. Bisher mussten Patienten generell nachweisen, dass ihr Arzt sie falsch behandelt hat und durch diesen Fehler ein Schaden verursacht wurde. Jetzt schreibt das Gesetz offiziell fest, was bisher schon gelebte Praxis war: Bei groben Behandlungsfehlern – die nicht näher definiert sind, aber nehmen wir als Beispiel ein bei einer Operation im Bauchraum vergessenes Operationsbesteck – muss der Patient Fehler und Schaden belegen, nicht aber den Zusammenhang zwischen beiden. Es ist Sache des Arztes zu beweisen, dass der Schaden nicht durch seinen Fehler entstanden ist.
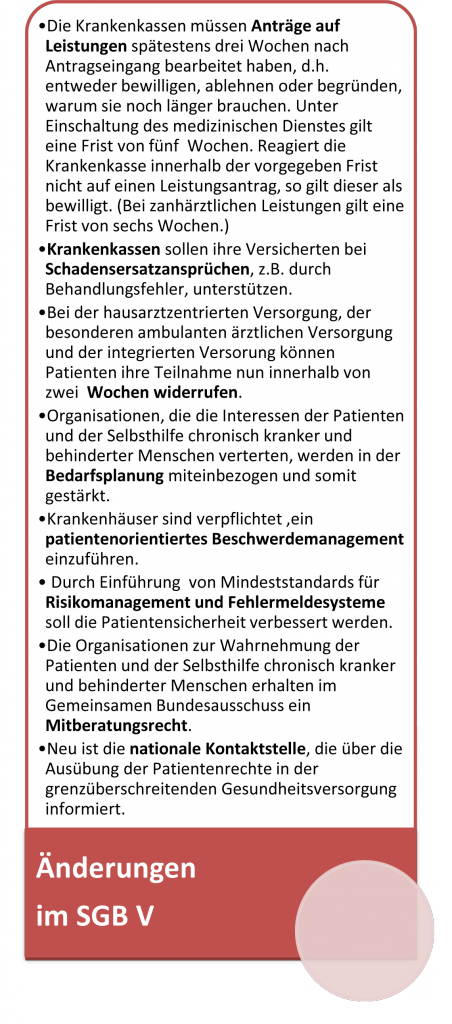
Bei „normalen“ Behandlungsfehlern bleibt die volle Beweislast beim Patienten. Vermutet etwa ein HIV-positiver Patient, dass seine massiven Leberprobleme auf Wechselwirkungen der antiretroviralen Therapie mit anderen Medikamenten zurückgeht, die sein Arzt nicht berücksichtigt hat, muss er nachweisen, dass ein Schaden existiert und eindeutig auf die falsche Medikamentenverordnung zurückzuführen ist. Neu ist, dass ihn seine Krankenkasse dabei – z.B. durch ein Gutachten – unterstützen soll; bisher war dies als Kann-Regelung eine reine Ermessensleistung. Die Verbraucherzentrale Hamburg vermisst hier eine verbindliche Pflicht und Sanktionen bei Nichterfüllung, billigt in ihrem Kommentar aber zu, dass „sollen“ immerhin mehr als „können“ sei und die Krankenkassen eine Unterstützung nicht ohne Begründung ablehnen dürften.
Die Beweislast erleichtern soll auch das keineswegs neue, jetzt aber in § 630 BGB Schwarz auf Weiß verbriefte Recht des Patienten auf Einsicht in seine Krankenunterlagen, in denen alle behandlungsrelevanten Informationen erfasst sein müssen. Wer im Internet zur Berichterstattung über dieses vom Bundesgerichtshof schon 1982 eingeräumte Recht recherchiert, mag ermessen, warum das Ringen der Lobbygruppen um das neue Gesetz viele Jahre gedauert hat: Das Recht ist bei vielen Ärzten nicht eben beliebt, bedeutet es doch nicht nur eine zeitraubende Störung des medizinischen Routinebetriebs; hinzu trete auch die „unerfreuliche Anmutung, das eigene ärztliche Handeln werde infrage gestellt und man solle überwacht, in Regress genommen oder gar verklagt werden“. Die Süddeutsche Zeitung vermutet gar eine Empörung der Ärzte über Patienten, die ihnen auf Augenhöhe begegnen wollen.
Der Patient muss fast alles beweisen
Wohlfahrts- und Selbsthilfeverbände hatten eine generelle Umkehr der Beweislast bei Behandlungsfehlern gefordert. „Der Patient muss fast alles beweisen, aber gerade bei multimorbiden Krankheitsbildern kann ein Zusammenhang zum Behandlungsfehler nicht unbedingt nachgewiesen werden“, erklärt Siiri Doka von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. „Gleichzeitig müssen wir den Patienten in einer sehr emotionalen Situation sehen, in der nicht nur Leib und Leben verletzt sind, sondern auch das Vertrauensverhältnis zum Arzt gestört ist.“ Nicht zuletzt seien selbst die Richter frustriert, wenn sie ein Verfahren ablehnen müssen, weil ein Gutachter einen Schaden nur zu 80 Prozent auf einen Behandlungsfehler zurückführen kann. Einen Grund für das Scheitern der Forderungen vermutet Siiri Doka in den erheblichen Konsequenzen, die eine Umkehr der Beweislast mit Blick auf die Versicherungen gehabt hätte: Vielen sei ein solches Risiko für Ärzte und andere medizinische Berufe schlicht zu hoch.
Sie sehen zwar gute und richtige Ansätze, doch insgesamt gibt es in dem Gesetz kaum einen Punkt, der im Urteil der Sozialverbände, Verbraucherzentralen und Patientenorganisationen gut wegkommt: Bei der Aufklärung vor medizinischen Eingriffen, die nun neben der schriftlichen Aufklärung auch im persönlichen Gespräch mit dem Arzt erfolgen muss und für den Patienten verständlich sein soll, hätten sie sich zum einen einen Patientenbrief gewünscht, der es dem Patienten erleichtert, Diagnose und Behandlungsempfehlungen nachzuvollziehen; zum anderen fehlt ihnen die Verpflichtung, bei sprachlichen Barrieren Dolmetscher heranzuziehen. Ebenfalls bemängelt werden die Regelungen zu den Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), zu denen Patienten häufig „offensiv geraten“ wird und für die sie jährlich 1,5 Milliarden Euro zahlen. Auf dem Verhandlungstisch hatte der Vorschlag gelegen, eine 24-stündige Bedenkzeit für die Patienten festzuschreiben oder sogar den Ärzten ausdrücklich zu verbieten, den Patienten IGeL unter Ausübung psychischen Drucks aufzudrängen.

Nicht einmal die Verpflichtung der Krankenkassen, über Leistungsanträge schneller zu entscheiden, findet uneingeschränkten Beifall. Nach dem Gesetz gilt ein Antrag als bewilligt, wenn die Kasse ihn nicht innerhalb von drei Wochen (bzw. fünf Wochen, wenn der Medizinische Dienst eingeschaltet wird) bescheidet, ohne eine Verzögerung schriftlich zu begründen. Der Versicherte kann sich dann die erforderliche Leistung selbst besorgen und der Kasse in Rechnung stellen. Aus Sicht der Verbraucherzentrale Hamburg ist jedoch unklar, wer prüft, ob die Leistung „erforderlich“ ist; auch für Siiri Doka von der BAG Selbsthilfe „ist die Geschichte ein bisschen heikel; ein Prozessrisiko hat der Versicherte schon. So muss der Antragssteller z.B. beweisen, dass sein Antrag bei der Krankenkasse eingegangen ist; am besten ist da ein Einwurf des Antrages bei der Krankenkassen unter Zeugen“.
Testanrufe in drei Kurkliniken vier Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes zeigten, dass zwei der drei Kliniken noch nichts von dem neuen Patientenrechtegesetz gehört hatten. Alle drei Kliniken machten deutlich, dass sie ohne eine Bestätigung der Kostenübernahme durch die Krankenkasse definitiv keine Reha veranlassen würden. Wie die Krankenkassen und alle Betroffenen mit nicht bearbeiteten Leistungsanträgen umgehen werden und welche Schwierigkeiten diese Regelung für die Versicherten nach sich zieht, wird man nach Einschätzungen der Unabhängigen Patientenberatung erst nach etwa einem Jahr sagen können.
Die UN-Behindertenkonvention wird nicht umgesetzt
„Höchst befremdlich“ ist für die BAG Selbsthilfe und den Paritätischen Gesamtverband aber das, was gar nicht erst Eingang in den Gesetzesentwurf gefunden hat: Die Bundesregierung habe die Schaffung eines Patientenrechtegesetzes in ihrem Nationalen Aktionsplan ausdrücklich als Maßnahme zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention ausgewiesen. Dort seien das Recht auf einen ortsnahen Zugang zu barrierefreien Gesundheitseinrichtungen und Mitspracherechte von Menschen mit Behinderungen bei der Ausgestaltung des Gesundheitswesens verbrieft. Beide Organisationen hatten in ihren Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf auf die völkerrechtliche Verpflichtung der Bundesregierung hingewiesen und Nachbesserungen gefordert – ohne Erfolg.
Siiri Dokas Fazit fällt entsprechend nüchtern aus: „Es ist gut, dass das Gesetz nach all den Jahren überhaupt gekommen ist; dann hat man nämlich die Möglichkeit, es zu verändern. So wie es im Moment ist, kann es nur ein erster Schritt sein.“ Nach dem Motto „besser als nichts“ scheint auch der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt zu haben. Obwohl viele ihrer Forderungen unberücksichtigt blieben, wollte die Länderkammer offensichtlich eine weitere Verzögerung des Gesetzes vermeiden. Mit Blick auf die dortigen aktuellen Mehrheitsverhältnisse hofft Sirii Doka, dass die Veränderungen bald angegangen werden.
Wenig Interesse an Veränderungen dürften die Ärzte haben. Die Verbraucherzentrale Hamburg zitiert Bundesärztekammer-Präsident Frank-Ulrich Montgomery aus der Ärztezeitung vom 16.1.2012: „Der Gesetzesentwurf entspricht im Wesentlichen dem, was wir mit dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung abgesprochen haben, und das ist eine Kodifizierung des bisherigen Rechts. Wir sehen in dem gegenwärtigen Gesetzesentwurf auf den ersten Blick eine Einlösung des Versprechens, das nicht gegen die Ärzte zu formulieren.“
Diesen Beitrag teilen




