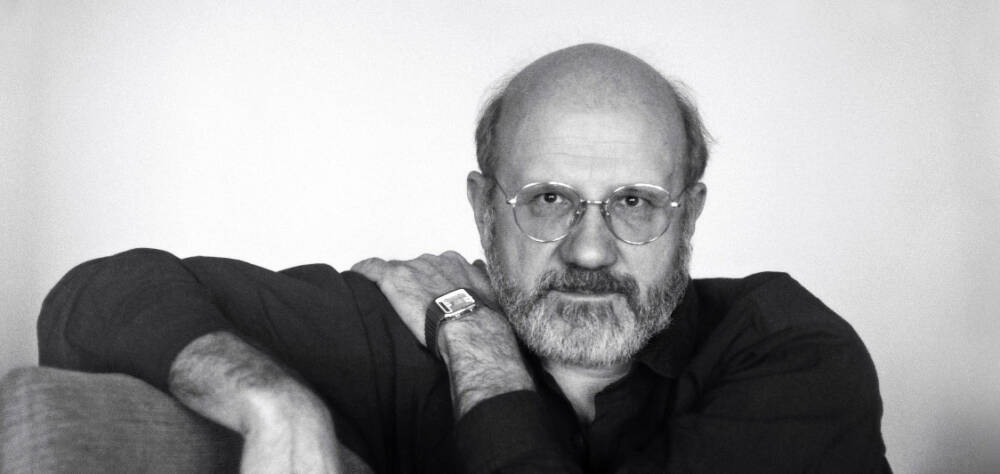Keine Behandlung und krankmachende Lebensumstände

Geflüchtete Menschen, die psychisch erkrankt sind, bekommen in Deutschland oft keine Behandlung. Die Psychosozialen Zentren können nur wenigen eine psychotherapeutische Versorgung ermöglichen – die Finanzierungslücke ist eklatant. Dabei zeigt das Beispiel von Wali Shafique*, was professionelle Unterstützung bewirken kann.
*Name geändert
Wali Shafique wirkt offen, selbstbewusst und zufrieden. Der 32-Jährige arbeitet im sozialen Bereich, er hat einen Job mit Verantwortung, einen, den er sehr gerne macht. In diesem Text wurde sein Name geändert, weil psychische Erkrankungen nach wie vor stigmatisiert sind und er seine berufliche Tätigkeit nicht gefährden möchte.
Ende September sitzen wir uns in einem Therapiezimmer von XENION e.V. gegenüber. Hier, in dem Psychosozialen Zentrum in Berlin, war Shafique eineinhalb Jahre in Therapie. Das Gespräch hat seine Therapeutin Livia Rebstock organisiert. Weil sie ihre Klient*innen schützen will, hat sie für meine Recherche eine Person gefragt, deren Behandlung bereits abgeschlossen ist. Sie ist bei dem Gespräch nicht dabei, gibt Shafique aber die Möglichkeit für eine Nachbesprechung.
Wali Shafique über seine Flucht„Unglaublich, wie ich das alles geschafft habe.“
Shafique kommt 2014 aus Pakistan nach Deutschland und beantragt hier Asyl. Über seine Flucht sagt er heute rückblickend: „Unglaublich, wie ich das alles geschafft habe.“ In Berlin wohnt er zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Es geht ihm sehr schlecht: Dem damals 21-Jährigen macht eine seltene chronische Erkrankung zu schaffen, er kann nur schlecht laufen, ist immer müde. Außerdem hat Shafique mit Panikattacken zu kämpfen. Er ist misstrauisch, wittert überall das Schlimmste. „Damals hätte ich dieses Gespräch nicht führen können“, sagt er. Shafique hatte immer Angst.
Heute wirkt Shafique zufrieden mit seinem Leben und seinem sozialen Netzwerk, er hat die deutsche Staatsbürgerschaft und eine erfüllende Arbeit. „Dass es mir besser geht, verdanke ich XENION und meiner Therapeutin“, sagt er. Er sei jetzt selbstbewusst und „gut integriert in der Stadt“.
Doch der Weg dahin war schwer. „Ich habe zwei Jahre auf einen Therapieplatz bei XENION gewartet“, sagt Shafique. Als Livia Rebstock ihn schließlich anrief, habe er gerade im Krankenhaus gelegen – und wütend aufgelegt. Nach dem Motto: Jetzt ist es auch zu spät. Dann habe er aber noch einmal nachgedacht und Rebstock zurückgerufen.
Nur ein Bruchteil der geflüchteten Menschen mit psychischen Erkrankungen wird behandelt
Es wird geschätzt, dass 30 Prozent der Geflüchteten potenziell eine psychologische Betreuung benötigen. In Deutschland wären das bei rund 3 Millionen Geflüchteten über 900.000 Personen. Die Zentren, die in der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e. V. (BAfF) organisiert sind, konnten 2023 rund 31.200 Personen behandeln oder weitervermitteln – und damit nur 3,3 Prozent des Bedarfs abdecken.
Diese Situation wird sich voraussichtlich im kommenden Jahr weiter verschärfen. Auf der Bereinigungssitzung zum 2026er Bundeshaushalt am 28. November wurde zwar eine drohende Kürzung abgefangen und eine Mittelausstattung von insgesamt 11,6 Millionen Euro beschlossen (2025 waren es 12 Millionen Euro). Jenny Baron von der BAfF will trotzdem nicht davon sprechen, dass die Finanzierungslücke damit geschlossen sei. „Laut einer Bedarfserhebung der BAfF und der Wohlfahrtsverbände bräuchte es 27 Millionen Euro aus Bundesmitteln, um die Angebote zu stabilisieren“, so Baron.
Jenny Baron, BAfFPsychosoziale Zentren zum Beispiel in Thüringen müssen Ende 2025 rund 60 Prozent ihres Fachpersonals entlassen. Dadurch wird die ohnehin schon knappe Versorgung weiter verschlechtert.
Neben den Bundesmitteln bekommen die Psychosozialen Zentren EU-Mittel, die über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verteilt werden. Für den Zeitraum 2025 bis 2027 waren diese bereits ausgeschöpft. Das BAMF gibt an, zusätzliche 60 Millionen Euro für die Psychosozialen Zentren akquiriert zu haben. Jenny Baron von der BAfF kritisiert aber, dass die Verteilung der EU-Mittel geändert wurde, sodass Mittel künftig nicht mehr direkt von den Zentren beantragt werden können, sondern nach dem Königsteiner Schlüssel zuerst an die Bundesländer verteilt würden. Das benachteilige Zentren in strukturschwachen Bundesländern. Die Folge: „Psychosoziale Zentren zum Beispiel in Thüringen müssen Ende 2025 rund 60 Prozent ihres Fachpersonals entlassen. Dadurch wird die ohnehin schon knappe Versorgung weiter verschlechtert.“
Die Bedingungen im Aufnahmeland sind entscheidend
Jenny Baron, BAfFWir wissen aus Studien mit Holocaust-Überlebenden: Entscheidend für den Genesungsprozess nach einem Trauma ist nicht die Schwere der Gewalt, sondern was danach passiert. Und das haben wir als Aufnahmegesellschaft in der Hand.
Entscheidend dafür, ob eine geflüchtete Person psychologische Behandlung benötigt, sind auch die Bedingungen im Aufnahmeland. „Eine Traumatisierung entsteht meist nicht durch ein einmaliges Ereignis wie einen Unfall. Oft sind das sequenzielle Prozesse“, erklärt Jenny Baron von der BAfF. Das heißt zum Beispiel: Menschen werden im Herkunftsland diskriminiert, erleben Gewalt, waren im Gefängnis, werden bedroht, haben jahrelang in Unsicherheit gelebt, um die Sicherheit ihrer Kinder, ihrer Familie, ihrer Freund*innen gebangt, müssen dann fliehen, erleben an den Außengrenzen immer brutalere Gewalt.
„Wir wissen aus Studien mit Holocaust-Überlebenden: Entscheidend für den Genesungsprozess nach einem Trauma ist nicht die Schwere der Gewalt, sondern was danach passiert. Und das haben wir als Aufnahmegesellschaft in der Hand“, sagt Baron. Doch hier erleben viele Geflüchtete Diskriminierung, leben unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern, haben Angst vor Abschiebungen und fühlen sich angesichts aktueller politischer Diskussionen immer weniger willkommen. „Auch bei Personen, die genug Ressourcen hatten, trotz der erfahrenen Gewalt gesund zu bleiben, wird die Belastungsschwelle durch die Lebensbedingungen in Deutschland oft überschritten“, sagt Baron.
Drei Jahre nur eingeschränkte Gesundheitsleistungen für Asylsuchende
Für Geflüchtete ist es kaum möglich, einen Therapieplatz über die Regelversorgung zu erhalten. Das psychotherapeutische Versorgungssystem in Deutschland ist ohnehin überlastet. Und Asylsuchende haben in den ersten drei Jahren in Deutschland nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur einen eingeschränkten Anspruch auf Gesundheitsbehandlungen. Vor Februar 2024 galt hier eine Dauer von zwei Jahren, sie wurde von der Ampelregierung auf drei Jahre verlängert. In dieser Zeit umfassen die Leistungen lediglich erforderliche ärztliche Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände. „Sonstige Leistungen“ können zwar gewährt werden, wenn dies im Einzelfall zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich ist. „Insofern besteht ein Anspruch auf psychotherapeutische Behandlung im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben“, so ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums.
Der Knackpunkt ist aber: „Psychotherapie ist in der Regel nur eine Kannbestimmung und muss in der Regel von den Sozialbehörden bewilligt werden. Die haben dafür aber keine guten Leitlinien, sodass Sachbearbeiter*innen ohne medizinische Kenntnisse über die Therapien entscheiden und diese oft ablehnen, obwohl die Person theoretisch einen Rechtsanspruch darauf haben müsste“, sagt Baron vom BafF.
Jenny Baron, BAfFSie [die Psychosozialen Zentren] übernehmen im Grunde den staatlichen Auftrag, Geflüchtete und Folterüberlebende zu versorgen. Es wäre deshalb das Mindeste, diese Strukturen so auszustatten, dass sie diesen Auftrag nachhaltig und flächendeckend in allen Bundesländern wahrnehmen können.
Da das Asylbewerberleistungsgesetz durch die Länder und Kommunen ausgeführt wird, gebe es keine Anweisung des Bundes hinsichtlich der Bewilligung psychotherapeutischer Behandlung, heißt es seitens des Bundesgesundheitsministeriums.
Die Psychosozialen Zentren versuchen, diese Lücke zu füllen. „Sie übernehmen im Grunde den staatlichen Auftrag, Geflüchtete und Folterüberlebende zu versorgen. Es wäre deshalb das Mindeste, diese Strukturen so auszustatten, dass sie diesen Auftrag nachhaltig und flächendeckend in allen Bundesländern wahrnehmen können“, so Baron.
Doch schon jetzt gibt es lange Wartezeiten. „Die Menschen finden oftmals über unser Sprechstundenangebot zu uns. Wenn sie psychologische Unterstützung suchen, laden wir zu einem Erstgespräch ein, bei dem der individuelle Bedarf geklärt wird“, erklärt Livia Rebstock von XENION. Im Anschluss würden sie entweder umgehend in ein Krisenprogramm aufgenommen oder kämen auf die Warteliste für Therapie. Alternativ verweist XENION sie an andere passende Stellen in Berlin.
Viele Geflüchtete leben in einem konstanten Alarmzustand
Livia Rebstock, XENIONViele unserer Klient*innen leben in einem konstanten Alarmzustand. Dadurch, dass sie hier Rassismus erleben, Angst vor Abschiebungen haben oder in den Medien davon hören, dass sie nicht erwünscht sind, hört dieser Alarmzustand nie auf.
Rebstock ist Verhaltenstherapeutin und arbeitet mit Traumainterventionen. „Bei unseren Klient*innen geht es in einem ersten Schritt darum, einen stabilen sicheren Raum herzustellen, bevor wir das Erlebte konfrontieren.“ Die häufigsten Diagnosen seien posttraumatische Belastungsstörung und Depressionen. „Die Menschen kommen oft in einem Zustand totaler Überforderung zu uns. Sie können schlecht schlafen, sind antriebslos, extrem angespannt und haben keinen Appetit“, erzählt Rebstock. Viele Menschen entwickelten ein bestimmtes Verhalten, um mit dem Erlebten umzugehen, das ihnen aber selbst schade, zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder Suizidgedanken.
„Viele unserer Klient*innen leben in einem konstanten Alarmzustand. Dadurch, dass sie hier Rassismus erleben, Angst vor Abschiebungen haben oder in den Medien davon hören, dass sie nicht erwünscht sind, hört dieser Alarmzustand nie auf“, sagt Rebstock.
In der Traumatherapie geht es darum, innere und äußere Sicherheit herzustellen. „Aber bei der äußeren Sicherheit sind wir sehr beschränkt in unserem Handlungsspielraum.“ In der Therapie nehme die Angst vor Abweisung in Deutschland viel Raum ein. „Es geht darum, diese Ängste zu validieren und ihnen zu zeigen, dass es nicht das Problem ist, wie sie fühlen, sondern wie mit ihnen umgegangen wird. Wir versuchen, das gemeinsam auszuhalten und auch der Wut Raum zu geben auf eine Gesellschaft, die so etwas erlaubt.“
„Für viele Klient*innen ist es schwer, eine Sprache dafür zu finden, was sie erlebt haben und auch hier weiterhin erleben, weil es so erschütternd ist“, sagt Livia Rebstock. Dabei spielen auch die unterschiedlichen Kontexte eine Rolle, in denen Behandler*innen und Klient*innen jeweils sozialisiert sind.
Livia Rebstock, XENIONDie Finanzierung wird immer weiter gekürzt, während der Bedarf an psychosozialer Unterstützung wächst.
Für Wali Shafique ist es letztlich gut gelaufen. „Er hat einen sinnstiftenden Job und fühlt sich – durch die Therapiebeziehung und viele andere positive Erlebnisse mit seinen Mitmenschen – zugehörig. Auch seine Fluchtgründe spielen eine Rolle: Er war politisch tätig und weiß, wofür er das gemacht hat. Er hat trotz aller Schwierigkeiten viel Selbstwirksamkeit erlebt“, sagt Rebstock. Aber das sei nicht unbedingt repräsentativ. Bei vielen Geflüchteten dauere es jahrelang, bis sie die Sicherheit haben, über traumatische Erlebnisse zu berichten und diese hinter sich lassen zu können.
Aktuell müssten Klient*innen bei XENION über ein Jahr auf eine Langzeittherapie warten. Vielen Psychosozialen Zentren in Deutschland gehe es ähnlich: „Die Finanzierung wird immer weiter gekürzt, während der Bedarf an psychosozialer Unterstützung wächst“, so Rebstock. Wie es bei XENION im nächsten Jahr weitergeht, ist auch jetzt nach Abschluss der Haushaltsverhandlungen noch unklar, alles werde unter Vorbehalt kommuniziert. „Es wäre so wichtig, Finanzierungssicherheit herzustellen, damit unsere Ressourcen in die psychosoziale Versorgung gehen können, statt dahin, Anträge zu schreiben“, sagt Rebstock.
Diesen Beitrag teilen