Wie KI-Zusammenfassungen zivilgesellschaftliche Vielfalt einschränken
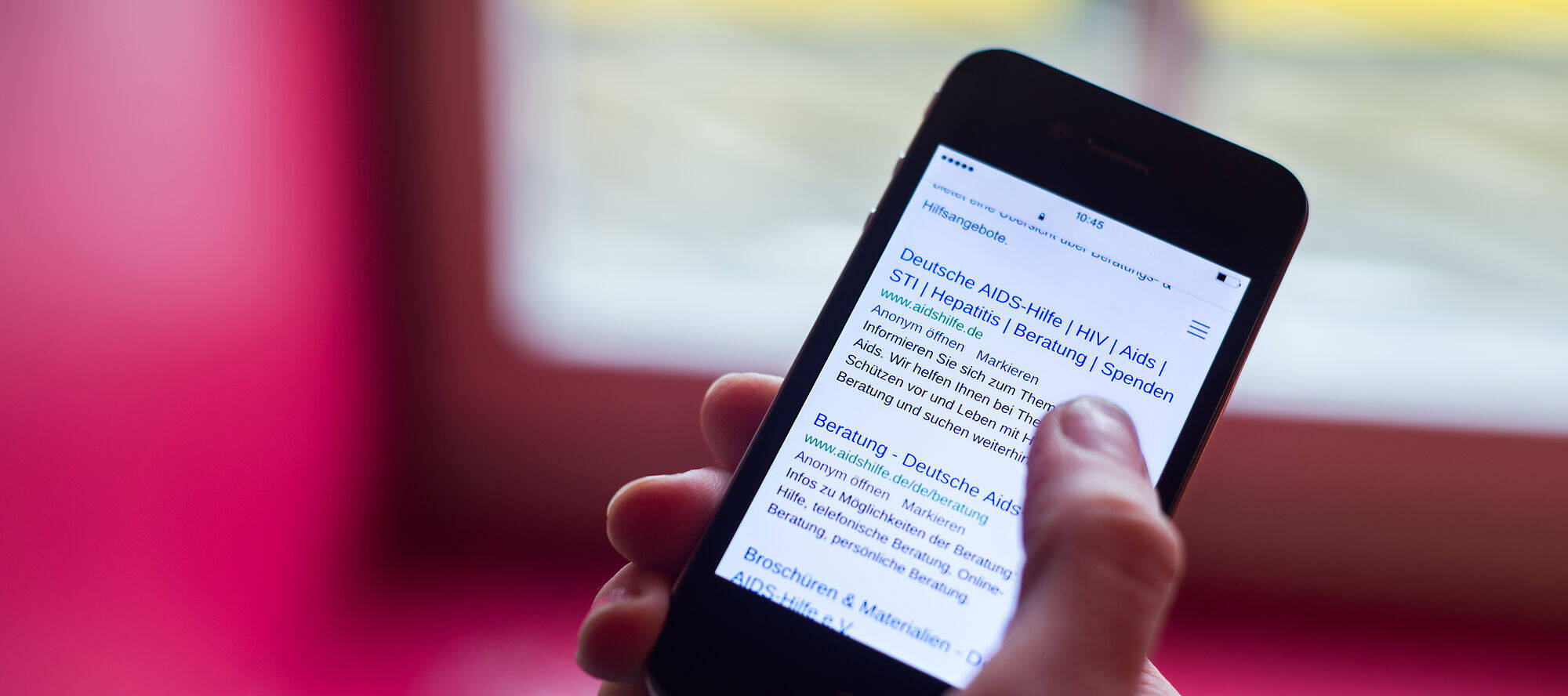
Wenn Chatbots und Google die Antworten bestimmen, verlieren NGOs Sichtbarkeit. Die Machtkonzentration weniger Plattformen bedroht die demokratische Vielfalt.
Der Beitrag wurde zuerst bei heise online veröffentlicht und erscheint hier mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Die Popularität von Chatbots großer „KI“-Modelle verändert, wie Menschen online suchen: Die vermeintlich wichtigsten Infos gibt es im direkten Dialog mit der „KI“ oder den automatisierten Zusammenfassungen in Suchmaschinen. Menschen bleiben so auf der Plattform. Die eigentlichen Expert*innen für ein Thema verkommen zur Fußnote oder bleiben ganz unsichtbar. Zivilgesellschaftliche Vielfalt ist von dieser Entwicklung bedroht.
Wann haben Sie das letzte Mal etwas gesucht, ohne auf der Seite der Suchergebnisse auf einen der Treffer zu klicken und eine der gelisteten Webseiten zu besuchen? Ihre Antwort ist „heute“? Sie sind damit in guter Gesellschaft: Mehr als jede zweite Suche endet laut einer Studie inzwischen ohne Klick. Das Phänomen „Zero-Click Suche“ wächst rasant.
Oder sind Sie viel seltener auf Google, weil die Beantwortung Ihrer Fragen über einen Chatbot wie ChatGPT oder Co-Pilot viel komfortabler ist oder irgendwie mehr Spaß macht? Auch damit sind Sie nicht allein: Google ist weiterhin weltweiter Marktführer, aber erstmalig seit vielen Jahren unter den Anteil von 90 Prozent gerutscht.
Auch in diesem Kontext muss man die Einführung von „KI“-Zusammenfassungen verstehen: Google listet zentrale „KI“-generierte Antworten direkt oben auf der Ergebnisseite und versucht damit zu demonstrieren, dass der Konzern ebenfalls „KI“ kann.
Die vermeintlich wichtigsten Infos gibt es im Dialog mit der „KI“ oder den Zusammenfassungen in Suchmaschinen. Menschen bleiben so auf der Plattform. Die Expert*innen bleiben unsichtbar.
Fachleute der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Verlage, die finanziell auf Webseitenaufrufe angewiesen sind, beobachten den Trend mit Sorge. Sie optimieren Texte, um wenigstens noch in der Seitenleiste der „KI“-Zusammenfassungen als Quelle genannt zu werden, oder beginnen mit sogenannter Generative Engine Optimization (GEO). Damit will man zum Beispiel erreichen, dass Sprachmodelle ihre Quellen, die sie ohnehin aus dem Internet gezogen haben, wenigstens mit angeben.
Das ändert aber nichts daran, dass sich die Zahl der Klicks auf Webseiten nach Suchanfragen drastisch reduziert hat.
Suchmaschinen tragen schon länger zu diesem Trend bei, indem sie viel ausführlichere Informationen direkt auf der Ergebnisseite platzieren. Info-Boxen am Anfang gehören inzwischen zum Standard. Auch sie verringern die Anzahl der Klicks, weil die zentrale Frage, nach der ein Mensch gesucht hat, bereits auf Google selbst beantwortet worden ist. Nutzende sparen sich so Zeit.
Google Suchmaschine ist selbst soziales Netzwerk
Seit Jahren wird über die Macht großer Plattformen und ihre Regulierung diskutiert, meist mit Blick auf soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder TikTok, X und LinkedIn. Doch auch Google folgt derselben Logik: Menschen sollen zunehmend auf der Plattform bleiben. Darum werden Klicks auf externe Seiten nicht gefördert, sondern durch Info-Boxen oder jetzt durch KI-Zusammenfassungen ersetzt.
Ein anderer Aspekt ist in der öffentlichen Wahrnehmung dagegen kaum angekommen: Nämlich, dass auch Google insofern ein soziales Netzwerk ist, als Signale der Nutzenden mitentscheidend darüber sind, welche Suchanfragen weit oben gelistet sind. Kehren die meisten nach wenigen Sekunden zurück zu Google, nachdem sie eine Seite besucht haben, wird das technisch oft als schlechtes Zeichen gewertet und die Seite verliert an Sichtbarkeit.
Plattformen und Machtkonzentration
Google ist damit längst mehr als eine Suchmaschine. Es funktioniert wie ein soziales Netzwerk: Das Verhalten der Nutzenden entscheidet darüber, welche Inhalte oben angezeigt werden, welche verdrängt werden und welche ganz verschwinden. Nur Inhalte, die in das Ökosystem passen und die Verweildauer erhöhen, haben eine Chance auf Sichtbarkeit.
Damit übt auch Google eine redaktionelle Funktion aus – ohne Transparenz und ohne demokratische Kontrolle. Was in der „KI“-Zusammenfassung als relevant erscheint, besitzt keinen neutralen Wahrheitswert, sondern ist ein durch Algorithmen gefilterter und auch von Geschäftsinteressen geprägter Ausschnitt.
Was wiederum in der „KI“-Zusammenfassung als das Wichtigste gilt, entscheidet allein Google. Ebenfalls wird diskutiert, ob man sich gesellschaftlich damit abfinden muss, dass Beiträge nach den Spielregeln der jeweiligen Plattform bewertet und ausgespielt werden. Allein an deren Ermessen entscheidet sich, ob zum Beispiel sexuelle Bildungsarbeit anstößig ist oder wo die Grenze liegt zwischen Meinungsfreiheit und Menschenfeindlichkeit.
Was gezeigt wird, ist politisch
Man kann sich dieser Frage inhaltlich nähern. Googelt man nach „Safer Sex“, listet die KI-Zusammenfassung „Kondome“, „Dental Dams“, die „Vermeidung von Körperflüssigkeiten“ und „saubere Sexspielzeuge“ als Strategien.
Zwei andere Methoden fehlen dagegen, obwohl sie beide zuverlässig vor HIV schützen: die PrEP, also die präventive Einnahme von HIV-Medikamenten, oder die Schutzwirkung einer HIV-Therapie. Die Deutsche Aidshilfe sieht in ihnen einen Schlüssel im Umgang mit der HIV-Pandemie.
Bei sexueller Bildung ist oft Tonalität entscheidend: Wie stark fokussiert man bei Aufklärung mögliche Krankheiten? Und wie kann man zugleich vermitteln, wie wichtig es ist, dass sich alle Beteiligten beim Sex wohlfühlen?
Im Fall illegalisierter Substanzen wie Heroin, Kokain oder Cannabis verzichtet Google dagegen weitgehend auf „KI“-Zusammenfassungen, statt aktiv auf mögliche Maßnahmen der Schadensminimierung und Safer Use hinzuweisen.
Was angezeigt wird und wie Texte formuliert sind, ist kein Zufall, sondern ein Ergebnis von Wahrscheinlichkeiten und Algorithmen, die weitgehend ohne öffentliche Kontrolle weiterentwickelt werden. Hier nehmen Google, ChatGPT und Co. mit jeder einzelnen Suchanfrage, mit jedem einzelnen Chatverlauf inhaltlichen und oft auch politischen Einfluss.
Wofür brauchen zivilgesellschaftliche Organisationen Sichtbarkeit?
Zivilgesellschaftliche Organisationen schauen mit einem weiteren Blickwinkel auf die Thematik. NGOs sind von der Förderung öffentlicher oder privater Unterstützung abhängig. Ihre Arbeit wird dabei mit Erfolgsindikatoren bewertet, wozu auch die Reichweite von Webseiten zählt. Warum sollte man etwas fördern, wenn vermeintlich niemand die Inhalte liest? Oder niemand ihre Angebote nutzt: Oft ist ein Besuch der Webseite nur der erste Schritt von Ratsuchenden, um eine Organisation kennenzulernen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Beratungsangebote werden nach inhaltlichen Suchanfragen wahrgenommen und gehen dann oft weiter in die Tiefe, als es Chatbots oder „KI“-Zusammenfassungen jemals abbilden könnten. Das eigentliche Anliegen kommt manchmal erst heraus, wenn man eine Weile telefoniert oder geschrieben hat. Mit Empathie, Geduld und feinfühligem Nachfragen. Dafür müssen Menschen aber erst einmal bei den Angeboten landen.
Beratungsangebote werden nach inhaltlichen Suchanfragen wahrgenommen und gehen dann oft weiter in die Tiefe, als es Chatbots oder „KI“-Zusammenfassungen jemals abbilden könnten.
Manche Organisationen sind darüber hinaus auf Spenden angewiesen, gerade angesichts knapperer Kassen bei öffentlichen Geldgebenden: Spendenwillige gelangen zunächst auf die Webseite der Organisation. Eine Anmeldung beim Newsletter erfolgt nicht über Google oder ChatGPT, sondern über den jeweiligen Online-Auftritt. Die Spendenkampagne zum Jahresende braucht Sichtbarkeit, um Wirkung zu entfalten.
Sicherlich haben gerade größere zivilgesellschaftliche Organisationen gute Chancen, den Herausforderungen zu begegnen: Ihre Kommunikationsteams buhlen um die verbleibende Aufmerksamkeit. Mit Werbebudgets umgarnen sie Spendenwillige. Ihren Domains wird eine größere Autorität zugeschrieben, was immer noch bessere Chancen auf Reichweite bringt, als sie neue oder kleine NGOs je haben werden.
Neue Vernetzung ist entscheidend
Die noch stärkere Konzentration von Macht bei wenigen Plattformen durch „KI“ bedroht zivilgesellschaftliche Vielfalt. Plattformen müssen verpflichtet werden, in „KI“-Zusammenfassungen ihre Quellen sichtbar und klickbar auszuweisen – und dabei auch kleinere Organisationen einzubeziehen. Für sensible Themen sollten eigene Zusammenfassungen entfallen oder zumindest mit relevanten zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Akteur*innen abgestimmt werden. Zudem braucht es Transparenz über die Auswahlkriterien und eine unabhängige Aufsicht, um demokratische Vielfalt zu sichern.
Für sensible Themen sollten eigene Zusammenfassungen entfallen oder zumindest mit relevanten zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Akteur*innen abgestimmt werden.
Diesen Beitrag teilen



