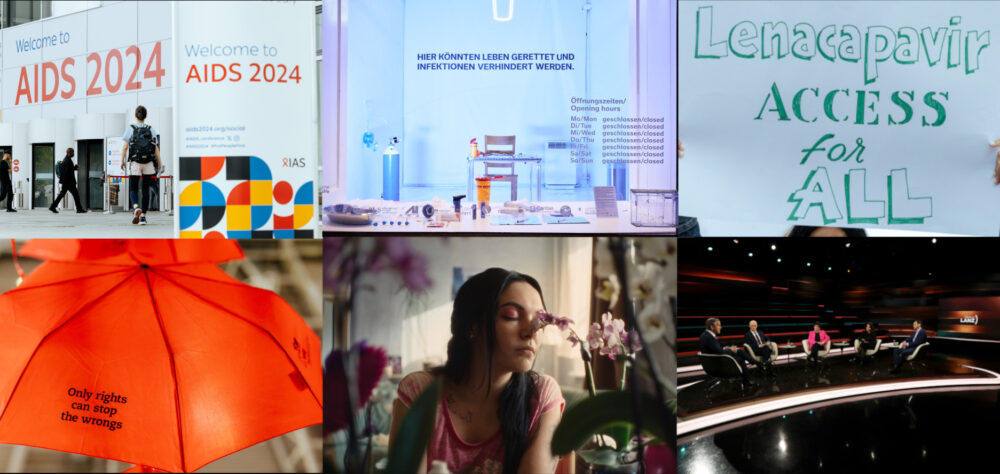Pionier der Schadensminimierung

Kaum ein anderer hat die Drogenarbeit so nachhaltig geprägt wie Heino Stöver – nicht nur aktivistisch, etwa als Vorsitzender des Bundesverbands akzept e.V., sondern auch als führender Wissenschaftler zu Drogenkonsum und Gesundheitsförderung sowie als Direktor des Instituts für Suchtforschung der Frankfurt University of Applied Sciences. Bereits im Juni 2024 hat Stöver die Leitung an seinen Nachfolger Prof. Dr. Bernd Werse übergeben. Mit seiner Emeritierung hat Heino Stöver nun vom Universitätsbetrieb Abschied genommen. Im Gespräch blickt er zurück auf Erfolge der Schadensminimierung.
Seit über 40 Jahren widmen Sie sich intensiv der Drogenpolitik und der damit verbundenen Gesundheitsförderung. Was hat Sie als Sozialwissenschaftler zu diesen Themen gebracht?
Ein emotionaler Auslöser war ein Fall in der Nachbarschaft in meiner Jugend. Ein junger Mann hatte Heroin genommen und ist später auch daran gestorben. Ein anderer Auslöser war ein Erasmus-Projekt, an dem ich als Student in Bremen mitgemacht habe. Dabei ging es um einen Vergleich der Drogenpolitiken in Berlin und Bremen sowie Edinburgh, London, Glasgow, Rotterdam und Amsterdam. Dadurch wurden mir die Augen dafür geöffnet, wo wir Anfang der 1980er-Jahre in Deutschland standen.
Mit der beginnenden Aidskrise erhielt die Problematik eine enorme Relevanz, sodass ich dann tief eingestiegen bin. In den ersten Jahren war das Thema stark von HIV dominiert, später rückten neue Aspekte, die Gesundheitsförderung, verstärkt in den Blick. Ich habe dann auch meine Dissertation und meine Habilitation darüber geschrieben.
Danach gründete ich mit einem Kollegen in Bremen den Verein „Kommunale Drogenpolitik/Verein für akzeptierende Drogenarbeit“. Wir hatten noch keine theoretische Grundlage dafür, sondern haben dies eher intuitiv und durch learning by doing entwickelt. Wir waren uns sicher, dass wir die betroffenen Menschen stärker mit einbeziehen müssen.
Die Beteiligung der Drogengebrauchenden etwa in der Bedarfsanalyse, der Entwicklung von gesundheitsfördernden Maßnahmen und deren Umsetzung ist der zentrale Punkt der progressiven HIV- bzw. Drogenpolitik. Sie haben diese durch Ihre Forschung über die Jahrzehnte mitgestaltet. Inwieweit ist die Partizipation tatsächlich gelungen?
Ich kann auf vier Jahrzehnte Drogenpolitik zurückblicken: Begonnen haben wir in einem System, in dem Betroffene nicht zu Wort kommen durften. Alles, was sie sagten, galt als krankheitsbedingt gestört. Aus dem gleichen Grund wollte man ihnen auch keine öffentlichen Gelder zur Selbstorganisation an die Hand geben. Die würden das ja gleich für Drogen ausgeben, so das Vorurteil. Das hat sich mit der Gesundheitsförderungsbewegung ab den 70er-Jahren verändert. Doch es dauerte, bis das in den Köpfen der Verantwortlichen in der Gesundheitspolitik und -hilfe ankam.
Heino StöverBegonnen haben wir in einem System, in dem Betroffene nicht zu Wort kommen durften. Alles, was sie sagten, galt als krankheitsbedingt gestört. … Das hat sich mit der Gesundheitsförderungsbewegung ab den 70er-Jahren verändert.
Im Bereich HIV und Aids hingegen war es anders. Dort sind die Betroffenen zu Aktivist*innen geworden und zum Beispiel Menschen aus der schwulen Community haben sehr schnell die Sache in die Hand genommen und ihre Rechte eingefordert.
Bei Drogenabhängigen war das nicht so?
Sie bedurften noch für gut zehn Jahre einer Unterstützung von außen. Erst mit der Gründung von JES gab es eine Organisation, mit der drogenkonsumierende Menschen für sich selbst sprechen konnten – bis heute ein Musterbeispiel. Wie die DAH die Gründung mit Mitteln aus ihrem Budget die Selbstorganisation gestärkt hat, ist ein gelungenes Beispiel moderner Gesundheitsförderungspolitik. Parallel dazu schossen in den 70er- und frühen 80er-Jahren Selbsthilfegruppen wie Pilze aus dem Boden, oft durch Länder und Kommunen finanziell gefördert. „Peer Driven Interventions and Consulting“, wie es in der Wissenschaft bezeichnet wird, ist ein Konzept, von dem Menschen stark profitieren, vielleicht sogar genauso stark wie von klassischer Schulmedizin.
Sie haben über Jahrzehnte unermüdlich für eine akzeptierende Haltung gegenüber Drogengebrauchenden und für schadensminimierende Maßnahmen geworben. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolge?
Da ist zum einen das Thema Harm Reduction. Früher gab es nur Abhängigkeit oder Abstinenz. In Bremen wurden wir zu Pionieren der Schadensminimierung, indem wir begonnen haben, Spritzen zu vergeben. Uns wurde der Vorwurf gemacht, vor der Sucht zu kapitulieren und sie lediglich zu verlängern. Aber wir blieben unbeirrt. Denn wir waren der Ansicht, dass es neben Abstinenz und Abhängigkeit auch das berechtigte Bedürfnis der Menschen gibt, weiteren Schaden zu vermeiden.
Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Wir haben damals zum Beispiel im Bremer Drogenviertel Infotische aufgebaut und Spritzen verteilt. Ich war erstaunt, dass die Reaktionen der Passant*innen überwiegend positiv waren. Die hatten verstanden, was wir hier machen – im Gegensatz zu vielen Funktionär*innen der Drogenhilfeverbände oder auch der Apothekenverbände, die versuchten, uns zu kriminalisieren. Das hat die flächendeckende Versorgung mit sterilen Spritzbesteck mindestens ein, zwei Jahre verzögert. Später haben wir in Bremen an einer Kirchenmauer den ersten Spritzenautomaten Deutschlands aufgestellt, und zwar anlässlich der WHO-Tagung zum Thema „Aids und Drogen“. Da traute sich der Senat nicht, ihn gleich wieder abzubauen.
Das Konzept ist schließlich zum festen Faktor der Drogenpolitik geworden, auf deutscher wie europäischer Ebene. Vergleichbares gilt für den Zugang zu Tests auf Hepatitis C und zur Behandlung oder die Einrichtung von Drogenkonsumräumen. Wie beim Spritzenautomaten haben wir auch hier nicht nach Genehmigungen gefragt, sondern sie in unserer Drogenkontakt- und Anlaufstelle eingerichtet, finanziert durch Eigenmittel und ABM-Gelder.
Etwas später wurde auch in einer vom Senat bezahlten Anlaufstelle für Sexarbeiter*innen eine Konsummöglichkeit geschaffen. Das ging so lange gut, bis die damalige Bremer Gesundheitssenatorin in einem Fernsehinterview davon erzählte. Am nächsten Tag stand die Polizei vor der Tür und hat den Laden geschlossen. Wir sind also immer wieder an die Grenzen der Legalität gegangen, um damit eine Veränderung zu provozieren. Und wir konnten über die Zeit das Konzept Schadensminimierung in andere Bereiche der Gesundheitsförderung hineintragen.
Der Begriff Schadensminimierung ist ja noch relativ neu. Damals, Mitte der 80er Jahre, war er wahrscheinlich ebenso unbekannt wie die „akzeptierende Drogenarbeit“.
Wenn wir ehrlich sind, wussten wir damals nicht exakt, was dieser Begriff eigentlich bedeutet, wir waren ja keine Sozialarbeiter. Aber wir haben ihn auf unsere Weise inhaltlich gefüllt und praktisch umgesetzt. Wir wollten, dass die Menschen, die wir begleiten, an den Entscheidungen beteiligt werden und wir diese Entscheidungen auch akzeptieren und sie wo nötig professionell unterstützen. Das hat eine Bewegung ausgelöst, die auch 1990 zur Gründung von Akzept e.V. geführt hat.
Und wo stehen wir heute?
Wir haben ein großes Netz an Kontakt- und Anlaufstellen sowie immerhin 30 Drogenkonsumräume. Jedoch haben nur die Hälfte der Bundesländer eine rechtliche Verordnung dazu. Und trotz der Teillegalisierung von Cannabis haben wir wirkliche Entkriminalisierung, die stets zur politischen Ausrichtung der akzeptierenden Drogenarbeit gehörte, noch nicht erreicht.
Sind Sie angesichts dieser Bilanz frustriert?
Ich sehe das Glas als halbvoll und glaube, dass wir in den letzten 40 Jahren einen Paradigmenwechsel in der Drogen- und generell Gesundheitspolitik geschafft haben. Schadensminimierung gilt inzwischen als eine legitime Zielausrichtung; wir sehen das etwa bei allen chronischen Krankheiten von Bluthochdruck bis Diabetes. Menschen können chronische Krankheiten nicht überwinden, also geht es darum, sie möglichst gut durch diese chronische Störung zu bringen. Und es gibt viele Tipps, wie Betroffene zu Beteiligten werden.
Heino StöverSchadensminimierung gilt inzwischen als eine legitime Zielausrichtung; wir sehen das etwa bei allen chronischen Krankheiten von Bluthochdruck bis Diabetes.
Akzept e.V. spielt in Ihrer Biografie eine wichtige Rolle. Gibt es für Sie Ereignisse, die Sie besonders in Erinnerung behalten werden?
Sehr stolz bin ich auf die erste europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft 2004, die ich gemeinsam mit Bärbel Knorr von der Deutschen Aidshilfe (DAH) auf die Beine gestellt habe. Inzwischen sind wir bei Konferenz Nr. 14 angelangt. Das Besondere dabei ist, dass wir hier – anfangs noch misstrauisch beäugt – Menschen von drinnen und draußen zusammenbringen, die sich um die Gesundheit von Gefangenen und zum Teil die der Bediensteten kümmern.
Zum anderen wäre da der Alternative Drogen- und Suchtbericht, den Akzept e.V. herausbringt, viele Jahre auch gemeinsam mit der DAH. Die Idee war, eine Gegenöffentlichkeit zum regierungsamtlichen Drogenbericht zu schaffen, der schwer zu ertragen war. Inzwischen liegt die 11. Ausgabe vor. Wir haben den Drogenbeauftragten das Monopol entzogen, allein die amtlichen Daten zu analysieren.
Heino StöverMit dem Alternativen Drogen- und Suchtbericht haben wir den Drogenbeauftragten das Monopol entzogen, allein die amtlichen Daten zu analysieren.
Sie haben immer wieder erlebt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, etwa zu Aspekten der Schadensminimierung, von den politisch Verantwortlichen lange ignoriert wurden. Wie hält man als Wissenschaftler diese Frustration aus?
Meine Frustrationstoleranz ist offenbar sehr hoch, sonst wäre ich nicht dabeigeblieben. Je dicker die Bretter sind, desto längeren Atem braucht man, um wenigstens kleine Veränderungen durchzusetzen. Viele andere fanden das zu frustrierend und haben aufgehört. Ich glaube, dass der Alternative Drogen- und Suchtbericht ein wichtiges Ventil ist, um die eigenen Vorschläge zur Drogenpolitik in Deutschland äußern zu können.
Die aktuelle Situation ist, genau betrachtet, fatal. Die Drogenstrategie der Bundesregierung stammt von 2012, ist also völlig veraltet. Das Thema Drogen wird in mehreren Ministerien eigenständig und unabhängig voneinander bearbeitet. So zählt Tabak zum Aufgabengebiet des Landwirtschaftsministeriums, illegale Drogen zum Gesundheitsministerium. Aber auch außen-, finanz- und wirtschaftspolitisch wird bei diesem Thema mitgemischt. Das Büro des Drogenbeauftragten ist im Grunde eine Alibistelle ohne Entscheidungskompetenz, ohne Mittel, nur für Grußworte bei Fachkonferenzen. Ganz anders ist es etwa in der Schweiz oder in Spanien, wo es große Expert*innengruppen gibt, die sich kompetent zu einzelnen Sachfragen äußern können. Auf Bundesebene war deshalb nie viel zu erwarten.
Ganz anders ist es auf Landes- und Kommunalebene, wo gesetzliche Rahmenbedingungen freier interpretiert werden und manche es wagen, in einem rechtlichen Graubereich mutig einen eigenen Weg zu gehen. So kam es eben zu den ersten Drogenkonsumräumen oder zum Drug-Checking in Berlin. Solche kleinen bedeutenden Fortschritte haben mich motiviert weiterzumachen.
Was ist Ihre Prognose: Wie wird sich die Drogenpolitik entwickeln?
Ich bin mir sicher, dass wir nicht mehr zu einer Politik zurückfallen können, wie wir sie unter den Drogenbeauftragen Marlene Mortler und Daniela Ludwig erlebt haben, als Drogenpolitik komplette Abstinenz bedeutete und der Reformstau überhaupt nicht angegangen wurde. Mit Burkhard Blienert hatten wir in den letzten drei Jahren einen Drogenbeauftragten, mit dem man tatsächlich auf Augenhöhe sprechen konnte. Das hat auch dazu geführt, dass Fachverbände ihre Forderungen heute mit einem größeren Selbstbewusstsein äußern.
Zugleich gibt es Entwicklungen, auf die die Drogenpolitik dringend reagieren muss. Etwa auf die Veränderungen bei den konsumierten Substanzen. In den Großstädten haben sich die offenen Szenen verändert und es zeigt sich vielerorts eine große Not.
Auf Bundesebene erwarte ich so gut wie nichts, da keine Gelder bereitgestellt werden. Ich sehe eher, dass die Länder und die Kommunen sich hier stärker engagieren müssen. Nachdem wir unsere Crack-Handlungsempfehlungen vorgestellt haben, zeigen die Reaktionen aus den Großstädten, dass man sich dort dieser Probleme bewusst ist. Bei vielen Städten bahnt sich faktisch eine Katastrophe mit gesundheitlichen wie sozialen Folgen an.
Heino StöverIm Rahmen eines EU-finanzierten Projekts haben wir Schlüsselstrategien identifiziert – von flächendeckenden Naloxon-Programmen und E-Health-Angeboten bis hin zu Drug-Checking.
Im Zuge der Heroinverknappung wird die Qualität des Stoffs schlechter und teurer werden; das Angebot synthetischer Opioide und der Mischkonsum werden zunehmen. Darauf sind die Kommunen nicht vorbereitet. Dabei haben wir bereits vor fünf Jahren im Rahmen eines EU-finanzierten Projekts unserer Universität genau dafür Schlüsselstrategien identifiziert – von flächendeckenden Naloxon-Programmen und E-Health-Angeboten bis hin zu Drug-Checking.
Drohen uns also nordamerikanische Verhältnisse?
Wir müssen uns darauf einstellen, dass in den nächsten Jahren etwas auf uns zukommen wird. Aber wir müssen es nicht zu einer Verelendung kommen lassen, wie wir sie in einigen US-Städten sehen. Wenn wir beispielsweise flächendeckend Drug-Checking auch in den Konsumräumen anbieten und alle Polizist*innen Naloxon am Gürtel tragen, können wir zumindest einen Teil der Risiken auffangen. Das müssen die Kommunen und Länder in die Hand nehmen.
In der Suchtmedizin droht uns ein Engpass. Engagierte Menschen gehen in Rente oder wechseln in andere Bereiche, gleichzeitig steigt der Bedarf an Substitutionsbehandlungen. Wie kann man dieser Entwicklung entgegensteuern?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Der neue Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin versucht dieser Herausforderung zu begegnen, aber uns läuft die Zeit davon. Ich sehe da auch die Kassenärztlichen Vereinigungen in der Pflicht, die letztlich den Versorgungsauftrag haben. Doch auch von deren Seite passiert zu wenig.
Ich bin bei Konferenzen jedoch immer wieder erstaunt, wie viele junge Menschen dorthin kommen und kluge Fragen stellten, also interessiert und im Stoff sind. Ich bin gar nicht so bang, dass es keinen Nachwuchs geben wird. Wir müssen mit unseren Möglichkeiten mithelfen, diese Menschen für unsere Arbeit zu begeistern.
Mit „wir“ meinen Sie Akzept e.V., Deutsche Aidshilfe und JES?
Richtig, diese drei Organisationen sind miteinander eine strategische Partnerschaft eingegangen, die bald ihre Goldene Hochzeit feiert. Wie in jeder guten Ehe kommt es zwar auch mal zu Spannungen, aber es gelingt uns doch immer wieder, Verbündete zu versammeln, gezielt Stiche zu setzen und Entwicklungen voranzutreiben. So wie etwa zuletzt die Verbesserungen bei der Diamorphinvergabe.
Seit 1. April sind Sie im Ruhestand. Was macht der Privatier Heino Stöver, sicherlich nicht die Beine hochlegen?
Ganz gewiss nicht, ich weiß gar nicht, wie Nichtstun geht. Ich bin aber erst einmal froh, aus der Uni und dem ganzen Forschungs-, Administrations-, Finanzierung- und Personalkarussell heraus zu sein. Solange ich atmen kann, werde ich mich um das Thema Gefängnisgesundheit kümmern. Das ist eines meiner Lebensthemen, die mich immer begleiten werden; andere sind illegale Drogen und – auch aus persönlichen Gründen – seit einigen Jahren Raucherentwöhnung, wo ich versuche, innovative Akzente zu setzen. Und selbstverständlich werde ich auch weiterhin bei Akzept e.V. aktiv bleiben.
Diesen Beitrag teilen