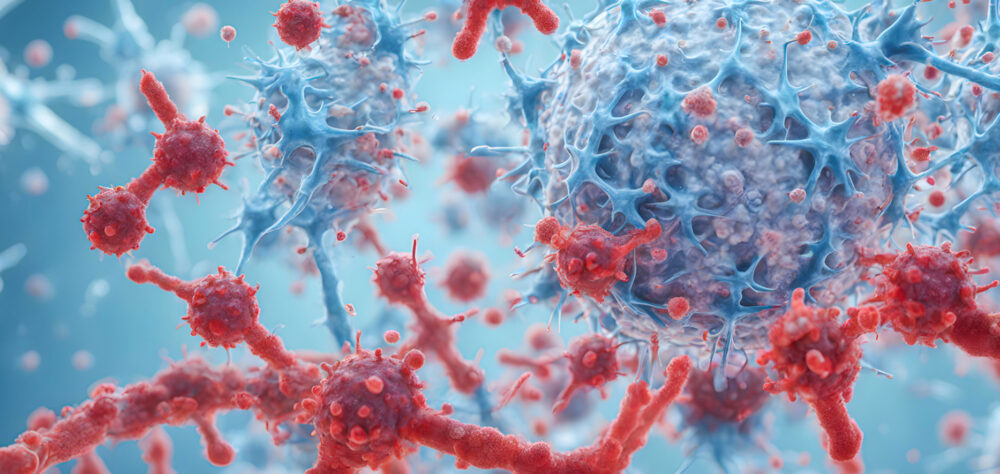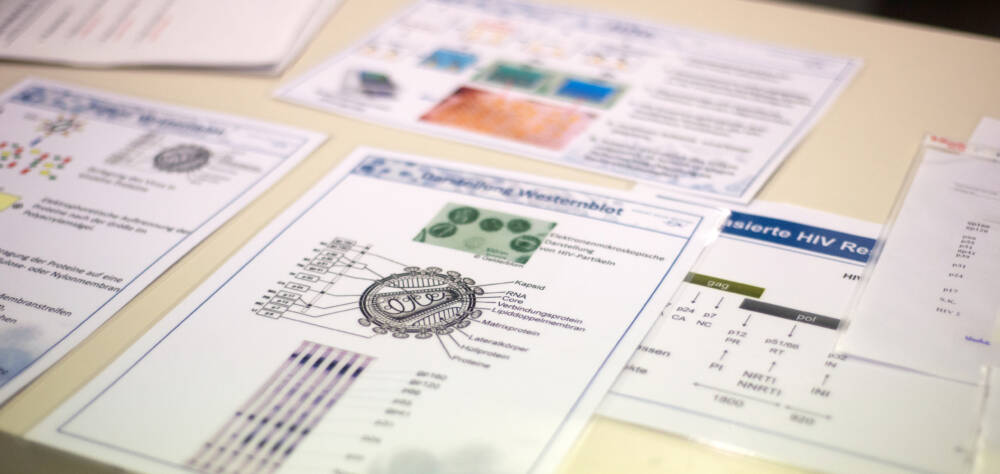Wegfall der US-Hilfen in Südafrika: Mütter mit HIV zahlen den Preis

Die Kürzungen bei den US-Hilfen haben verheerende Folgen für Schwangere und Stillende mit HIV in Südafrika. Bewährte Strukturen sind plötzlich nicht mehr da – und Mütter erhalten nicht die Versorgung, die sie dringend brauchen.
Nach 17 Jahren in Organisationen, die vom US-Programm zur Bekämpfung der weltweiten HIV/Aids-Epidemie „PEPFAR“ finanziert wurden, musste Natasha Davies ihre Arbeit mit schwangeren und stillenden Frauen in Südafrika aufgeben. Die drastischen Kürzungen bei den US-Auslandshilfen trafen auch das ANOVA Health Institute, für das sie tätig war. Die NGO wurde von 3.500 auf 150 Mitarbeitende geschrumpft, fast alle klinischen Fachkräfte verloren ihren Job. Seit Juli 2025 arbeitet Davies als Ärztin in einem Krankenhaus in Johannesburg – zurück in der klinischen Versorgung, aber fern von ihrer Spezialisierung in der HIV-bezogenen Mutter-Kind-Betreuung. Im Interview spricht sie über die Herausforderungen bei der Begleitung von Schwangeren und Stillenden mit HIV in Südafrika und die Auswirkungen der US-Kürzungen.
Vor welchen Herausforderungen stehen Schwangere mit HIV in Südafrika?
Es gibt verschiedene Gruppen von Frauen. Die einen erfahren erst während der Schwangerschaft, dass sie HIV haben. Das ist ein Schock. Hinzu kommt die Sorge, dass das Virus auf ihr Baby übertragen wird. Sie müssen sich erst an die Medikamente gewöhnen. [Anm. d. Red.: Die Behandlung mit HIV-Medikamenten schützt zum einen die Gesundheit der schwangeren oder stillenden Person, zum anderen verhindert sie die Übertragung von HIV auf das Baby während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Dafür müssen die Medikamente konsequent eingenommen werden.]
Dann gibt es Frauen, die wegen psychischer Probleme, wegen der Angst, ihre Krankheit offen zu legen, oder wegen finanzieller Herausforderungen Schwierigkeiten haben, jeden Tag ihre Medikamente zu nehmen. Bei ihnen ist das Virus außer Kontrolle, was nicht nur für sie problematisch ist, sondern auch das Risiko für ihre Babys erhöht, HIV zu bekommen.
Dann hat etwa eine von vier Frauen in Südafrika immer noch eine fortgeschrittene Erkrankung, die ihr Immunsystem betrifft. Während der Schwangerschaft wird das noch schlimmer. Diese Frauen haben ein höheres Risiko, dass sie ihr Baby verlieren oder es zu früh oder zu klein geboren wird.
Wie hoch ist das Risiko einer HIV-Übertragung auf das Kind nach der Geburt?
In Südafrika bekommen drei von vier Babys, die sich mit HIV infizieren, das Virus durch das Stillen. Viele der Frauen werden zwar während der Schwangerschaft betreut – Pflegekräfte arbeiten hart daran, dass sie bei der Geburt gesund sind und das Baby HIV-frei geboren wird. In der Stillzeit aber ist die Unterstützung nicht so gut.
Postnatale Depressionen sind häufig, dazu kommt oft geschlechtsspezifische Gewalt. Stillende stehen vor vielen Herausforderungen.
Die Herausforderungen nehmen zu, weil ein neues Baby da ist, hinzu kommen die Klinikbesuche. Viele Mütter ziehen nach der Geburt um. Sie gehen zur Oma in ländliche Gebiete, dann kehren sie in die Städte zur Arbeit zurück. Die Kliniken verlieren sie aus den Augen.
Postnatale Depressionen sind häufig, dazu kommt oft geschlechtsspezifische Gewalt. Stillende stehen vor vielen Herausforderungen. Das Virus gerät dann außer Kontrolle, es wird beim Stillen auf das Baby übertragen, weil unsere Betreuung nach der Geburt nicht so gut ist wie während der Schwangerschaft.
Warum empfehlt ihr nicht einfach Säuglingsnahrung statt Stillen?
In Südafrika gibt es zu viele Säuglingskrankheiten und -todesfälle, die mit Säuglingsnahrung zusammenhängen. Die Haupttodesursachen bei unter Fünfjährigen sind Durchfallerkrankungen, Lungenentzündung und Mangelernährung – alles stark durch Säuglingsnahrung getrieben. [Anm. d. Red.: In Südafrika gibt es nicht immer Zugang zu ausreichend hygienischen Bedingungen und sauberem Trinkwasser für die sichere Zubereitung von Babynahrung.] So wird trotz des HIV-Risikos das Stillen empfohlen. Aber der Druck liegt auf den Gesundheitsdienstleistenden zu gewährleisten, dass Frauen mit HIV sicher stillen, und darin sind wir nicht gut. Einerseits ermutigen wir zum Stillen, unterstützen die Frau dann aber nicht ausreichend, das Virus unter Kontrolle zu halten.
Die Übertragungsraten sind in den letzten zehn Jahren unglaublich gesunken: Jetzt bekommen etwa drei bis vier Prozent der Babys HIV, damals noch 20 Prozent. Bei diesen drei bis vier Prozent sieht man immer den Grund, warum die Stillende durchs Raster gefallen ist.
Warum läuft es in diesem Bereich nicht besser?
Wir haben „Baby Well“-Kliniken, wo Mütter Babys impfen lassen und die sehr gut angenommen werden. Aber die Krankenpfleger*innen sind so beschäftigt mit der Betreuung der Babys, dass sie es nicht schaffen, nach der Mutter zu sehen. Mutter- und Babybetreuung sind nicht integriert: Von der Mutter wird erwartet, dass sie für sich selbst eine andere Pflegekraft aufsucht, und wenn sie das nicht tut, bemerkt es niemand. Wir reden seit mehr als zehn Jahren darüber, dass Mutter und Baby zusammen betreut werden müssen. Aber es gibt einfach nicht genug Pflegekräfte.
Der Druck liegt auf den Gesundheitsdienstleistenden zu gewährleisten, dass Frauen mit HIV sicher stillen, aber darin sind wir nicht gut.
Seit den Kürzungen bei PEPFAR haben wir so viele Beratende verloren, die geholfen haben, diese Frauen zu betreuen. In Johannesburg hatten wir Clubs etabliert, wo Mutter und Baby gemeinsam Selbsthilfegruppen besuchten – mit einer Moderatorin, die beide im Auge behielt. In den letzten zwei Jahren hat sich nur ein Baby mit HIV infiziert. Da hatte die Mutter die Nachsorge verpasst. Keines der anderen Babys, die sechs bis zwölf Monate in so einem Club waren, hat HIV bekommen. Sobald die Finanzierung ausfiel, brachen die Clubs zusammen.
Wie wirken sich die Kürzungen noch auf Schwangere, Stillende und das Klinikpersonal aus?
Die Datenarbeit wurde vorher von beauftragten Partnerfirmen gemacht. Sie erfassten alle Besuche einer Person, die Blutergebnisse usw. in Datenbanken. Probleme konnte man so erkennen. Es gab zum Beispiel Listen für verpasste Termine oder hohe Viruslast-Resultate. Das ist jetzt alles weggefallen.
Meine Hauptsorge ist, dass Frauen, denen es nicht gut geht, nicht schnell genug identifiziert werden, weil beim Personal Chaos herrscht. Sogar die Ablage wurde von Partnerfirmen gemacht, jetzt brechen die Ablagesysteme zusammen. Wenn eine Mutter mit ihrem Baby kommt, wird ihr vielleicht gesagt: „Wir können deine Akte nicht finden. Hier ist eine neue.“ Dann fehlen den Beratenden die Vorgeschichte oder die alten Resultate. Die Frau kann nicht mehr so gut betreut werden. Frauen, die nicht zu Terminen erscheinen, wird niemand ausfindig machen.
Sorgen bereitet auch die Bestandskontrolle. Wir haben genug Medikamente im Land, doch manchmal zwar genug in der einen, aber nicht in der anderen Klinik. Partner waren bislang eine große Unterstützung beim Lieferketten-Management.
Auch die Einbindung der psychischen Gesundheit, etwa Screenings auf postnatale Depression oder geschlechtsspezifische Gewalt, wurde von Partnern unterstützt und ist nun weggefallen, weil die Pflegekräfte zu viel Arbeit haben und es zu wenig Personal gibt.
Dasselbe gilt für die Familienplanung. Wir arbeiteten intensiv daran, das Thema Verhütung einzubinden. Das ist auch weggefallen. Bis zu drei Viertel der Frauen mit HIV werden ungewollt schwanger. Es wird also mehr Schwangerschaften geben – und das macht es wieder schwieriger, sich um die Frauen zu kümmern. Ein Teufelskreis.
Bis zu drei Viertel der Frauen mit HIV werden ungewollt schwanger.
Gibt es Bestrebungen der Regierung oder anderer Akteure*innen die Lücke zu füllen?
Bisher kam nicht viel von anderen Akteur*innen, nicht aus Europa oder Asien. Das südafrikanische Gesundheitsministerium hat uns gründlich enttäuscht. Unser Gesundheitsminister beharrt darauf, dass das vorhandene Personal es schafft, obwohl das Personal vor Ort sagt, dass sie es nicht schaffen können.
Eine Einrichtung, mit der ich arbeite, hatte früher vier „Tracer“: Beratende, die Vollzeit angestellt waren, um die Personen zu kontaktieren, die Termine verpasst haben. Diese Nachverfolgung war entscheidend, um Leute in der Behandlung zu halten, weil das Leben in unserem Land chaotisch ist. Armut, Arbeitslosigkeit, Gewalt machen das Leben unvorhersehbar.
Jetzt haben sie nur noch zwei, die alles machen müssen: testen, beraten, nachverfolgen. Sie können es nicht schaffen, und es gibt keine Bemühungen, verlorenes Personal zu ersetzen.
Gibt es ganz konkrete Beispiele von Frauen, die von den Kürzungen betroffen sind?
Eine 29-jährige Frau mit einem drei Monate alten Baby ist letzten Mittwoch gestorben. Ihr ging es die ganze Schwangerschaft über nicht gut. Bei einer Schulung habe ich die Pflegerin getroffen, die sie betreut hat. Sie wandte sich an mich, weil es in ihrer Einrichtung niemanden gab, den sie rufen konnte, als es der Frau schlecht ging. Aber als ich sie dann sah, war es zu spät. TB hatte sich in ihrem Körper ausgebreitet und ihr HIV war nicht kontrolliert. Das drei Monate alte Baby ist jetzt eine Waise. Dieser Tod hätte verhindert werden können.
Es gibt keine Bemühungen, verlorenes Personal zu ersetzen.
Wir hatten eine TB-HIV-Hotline, die Mitarbeitende des Gesundheitssystems kostenlos anrufen konnten, aber sie funktioniert nicht mehr wie früher. Wenn nun Klinikmitarbeitende komplizierte Fälle sehen, bekommen sie nicht so leicht Unterstützung oder sie wissen nicht, wohin sie die Patientin vermitteln sollen.
Würdest du klar sagen, dass diese Mutter wegen der Kürzungen gestorben ist?
Es gab viele Faktoren, aber ich denke, wenn es in dieser Klinik mehr Personal gegeben hätte und die Pflegerin jemanden hätte rufen können … Sie wäre vielleicht sowieso gestorben, aber die Situation wurde verschlimmert, weil es niemanden gab, der mitbekam, dass sie nicht auf die Behandlung ansprach.
Als wir noch Partner hatten, gab es Leute, die man anrufen konnte, und Ärzt*innen, die durch die Stadt fuhren, um nach Patient*innen zu schauen, denen es nicht gut ging. Diese Unterstützung ist seit Januar weggefallen.
So viele der Frauen, um die ich mich früher gekümmert habe, kämpften täglich damit, die Medikamente zu nehmen, oft wegen Depressionen, Ängsten oder Traumata. Sie brauchten jemanden, der Zeit hatte, um sie bei der Bewältigung ihrer Probleme zu unterstützen und resilienter zu werden. Jetzt haben die Mitarbeitenden keine Zeit, sondern sind überfordert.
So viele der Frauen, um die ich mich früher gekümmert habe, kämpften täglich damit, die Medikamente zu nehmen.
Acht von zehn Frauen werden okay sein, sie bekommen Medikamente, nehmen sie, das Virus ist kontrolliert, es wird nicht auf das Baby übertragen. Aber es gibt jene, die mehr Betreuung brauchen, und das Gesundheitsministerium gibt keinen Spielraum dafür. Die Pflegekräfte sind erschöpft und überarbeitet – mit 50 bis 60 Patient*innen täglich. Du hast keine Zeit für jemanden, der depressiv ist. Du kannst nicht mal die Frage danach stellen, weil das mehr Arbeit schafft.
Gibt es andere Beispiele?
Vor den Finanzierungskürzungen traf ich eine 19-Jährige aus Simbabwe, die nicht in Behandlung und schwanger mit Zwillingen war. Weil sie Ausländerin war, war es schwierig für sie, Zugang zu Behandlung zu bekommen. Sie landete im Krankenhaus. Sie hatte kein Essen und kein Zuhause, sondern schlief bei jemandem auf der Couch. Sie kämpfte damit, die Medikamente zu nehmen.
Mit Partnern vor Ort hatten wir ein ganzes Netzwerk, um sie an Stellen zu vermitteln, die ihre sozialen Probleme lösen konnten. Eine Sozialarbeiterin vermittelte sie an ein Frauenhaus, sie bekam Essen und schaffte es, ihre Viruslast vor der Geburt zu kontrollieren. Dieses Netzwerk ist weggefallen.
Was es schlimmer macht: In Johannesburg wie auch in anderen Provinzen verschärft sich derzeit die fremdenfeindliche Stimmung. Südafrikaner*innen stehen vor Gesundheitseinrichtungen und blockieren Ausländer*innen den Zugang zu HIV-Behandlung, Schwangerschafts- und Babybetreuung.
Die Pflegekräfte sind erschöpft und überarbeitet – mit 50 bis 60 Patient*innen täglich.
Die Kürzungen haben ein Klima geschaffen, in dem diese Fremdenfeindlichkeit gedeihen kann, weil wir keine Mitarbeitenden vor Ort haben, die für diese Frauen einstehen. Das Personal vom Gesundheitsministerium macht es nicht, denn sie sagen: „Diese Leute stehen draußen, wir mischen uns nicht ein.“
Heute habe ich eine Frau aus Simbabwe getroffen, die eine lokale Klinik besucht hat. Sie ist in Behandlung, wurde während der Schwangerschaft diagnostiziert, das Baby ist jetzt vier Monate alt. Sie wurde zweimal abgewiesen, weil sie Ausländerin ist. Ich half ihr, im Krankenhaus behandelt zu werden. Sie bekommt aber keine Verhütungsmittel, könnte also wieder schwanger werden, und ihrem Baby fehlen die nötigen Impfungen, weil im Krankenhaus nicht geimpft wird. Wenn die Partner noch da wären, würde ich anrufen und sagen: „Kannst du dieser Frau helfen, hier reinzukommen?“ Wir wären eher in der Lage, uns gegen diese Bullys zu wehren. Das Personal vom Gesundheitsministerium ist dagegen in einer schwierigen Lage bezüglich ihrer eigenen Sicherheit, wenn es sich gegen diese Leute wendet.
Wenn du eine Sache bei den Anstrengungen gegen die HIV-Übertragung während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit ändern könntest, was wäre das?
Es wäre leicht für das Gesundheitsministerium, Budgets freizugeben, um diese Club-Moderatorinnen für Mütter nach der Geburt anzustellen. Wir haben wirklich gezeigt, dass das funktioniert. Wenn wir mehr Mütter in Selbsthilfegruppen bekommen könnten, bekämen sie psychologische Unterstützung von anderen Müttern. Mutter und Baby werden zusammen betreut, und die Moderatorin merkt, wenn eine Mutter nicht auftaucht. Es schließt viele Lücken auf einmal.
Diese Moderatorinnen sind ziemlich erschwinglich, weil sie Laiinnen sind. Es sind Frauen, die mit HIV leben, die wir „Mentor-Mütter“ nennen. Es sind keine hochqualifizierten Mitarbeiterinnen, aber sie sind sehr wertvoll. Im Gesundheitswesen gibt es viel Verschwendung, die die Regierung durch die Bekämpfung von Korruption und Missbrauch von Mitteln reduzieren könnte.
Wir sind hier völlig gelähmt durch reiche Länder, die weiterhin unsere Ressourcen absaugen.
Gibt es andere wichtige Themen?
Europa hat verfügbares Geld! Alle jammern über Armut, aber eine Sache, die mich – ich bin aus dem kolonialen Land Großbritannien und lebe in einem Land, das durch Kolonialismus untergraben wurde – verrückt macht, sind die Schuldenrückzahlungen: So viel des südafrikanischen BIP fließt in Rückzahlungen statt in Gesundheit und Bildung. Wir sind hier völlig gelähmt durch reiche Länder, die weiterhin unsere Ressourcen absaugen.
Die PEPFAR-Finanzierung wäre nie nötig gewesen, wenn afrikanische Länder nicht immer noch durch Rückzahlungen gelähmt wären, die darauf zurückgehen, dass diese Länder um ihre Unabhängigkeit kämpften und lächerliche Kredite bekamen. Sie hätten Reparationen bekommen sollen, nicht Kredite.
Diesen Beitrag teilen