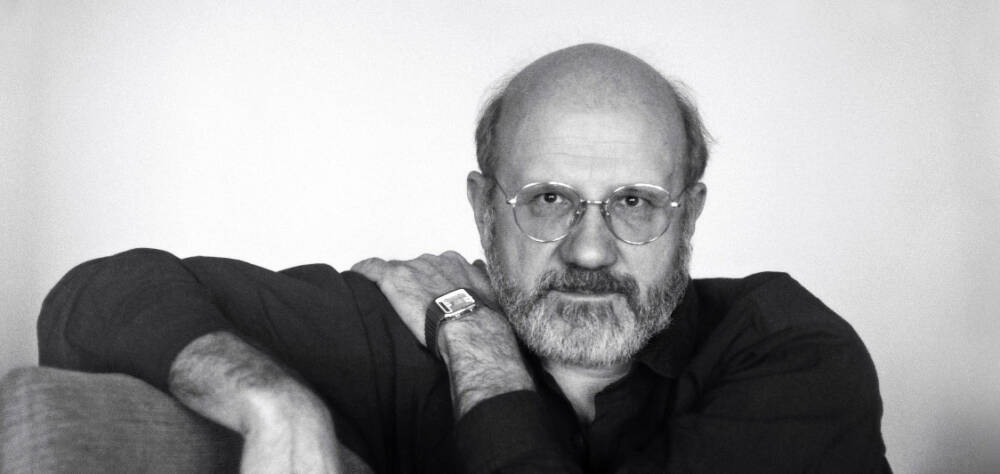Aidsgeschichte: „An Forschungsthemen mangelt es keineswegs“

Die Aidskrise in den 80er- und 90er-Jahren hat die Gesellschaft auf vielfältige Weise nachhaltig geprägt. Doch erst nach und nach wächst die geschichtliche Aufarbeitung. Im Gespräch berichtet Prof. Nicole Kramer von ihren Erfahrungen um ihre Seminare zur Aidsgeschichte am Historischen Institut der Universität Köln.
Inzwischen haben Sie bereits zwei Seminare zur Aidsgeschichte im Fachbereich Neuere Geschichte an der Universität Köln durchgeführt. Wie kam es dazu?
Der Impuls kam nicht aus der Universität selbst, sondern von außen – genauer gesagt von der Aidshilfe Köln. Es gab die Idee, Aids-Geschichte stärker in universitäre Kontexte zu bringen. Gemeinsam mit meiner Kollegin Ulrike Lindner, die sich mit Politik-, Gesundheits- und Geschlechtergeschichte beschäftigt, haben wir 2023 ein Hauptseminar im Rahmen des Masterstudiengangs Public History und Neuere Geschichte angeboten. Dieses erste Seminar hatte einen politikgeschichtlichen Fokus, wobei neben Regierung und Parlament auch der Umgang der Zivilgesellschaft mit der Aids-Krise im Fokus stand. Wir haben uns zum Beispiel mit der Auseinandersetzung innerhalb der CSU und CDU um die „richtige“ Aids-Strategie beschäftigt.
Wie war das Interesse der Studierenden?
Erfreulich groß. Ein Indikator dafür ist, dass gleich mehrere Abschlussarbeiten entstanden sind – darunter zwei Masterarbeiten und eine Bachelorarbeit. Einer dieser Studierenden hatte für seine Arbeit den HIV-Aktivisten Michael Jähme als Zeitzeugin interviewt. Dieser hat mich dann angesprochen, mir seine Forschungen zur Aids-Geschichte Kölns vorgestellt – und so kam es, dass wir für 2025 ein Blockseminar entwickelt haben, nun mit dem Schwerpunkt auf der Sozial- und Emotionsgeschichte von Aids. Es gab sogar so viele Anmeldungen, dass ich gar nicht alle Interessierten ins Seminar aufnehmen konnte. Das lag sicherlich auch daran, dass sich nicht nur Studierende des Masterstudiengangs Public History angesprochen fühlten, sondern etwa auch Lehramtsstudierende. Das ist insofern bemerkenswert, da diese sich aus nachvollziehbaren Gründen gerne Themen wählen, die sie später auch im Unterricht behandeln können. Das ist bei der Geschichte von Aids durchaus diskussionswürdig. Im Laufe des Semesters haben wir dann auch diskutiert, wie das Thema in der Schule integriert werden könnte.
Eine weitere Teilnehmendengruppe kam aus dem interdisziplinären Masterstudiengang Gender und Queer Studies. Diese Studierenden hatten zumeist keinen geschichtswissenschaftlichen Hintergrund, brachten aber ein besonderes Theoriewissen ein. Insofern hatten wir eine sehr diverse und interessante Mischung.
Die Studierenden haben die Aidskrise ja selbst nicht miterlebt und daher keine persönlichen Berührungspunkte. Welche Aspekte und Fragestellungen waren für sie interessant?
Viele der Teilnehmenden betonten, wie aktuell sie das Thema empfanden. Und auch, dass sie das Seminar weniger in der Geschichtswissenschaft, sondern eher in der Sozialwissenschaft verortet hätten. Natürlich denken wir zunächst an die 80er-Jahre, wenn wir über die Aids-Geschichte sprechen. Aber HIV und Aids sind auch heute noch Themen – seien es Behandlungsmöglichkeiten, veränderte Infektionszahlen oder die Folgen der Trump-Politik für die Medikamentenversorgung. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, an aktuelle Debatten anzuschließen.
Was hat Sie persönlich als Historikerin daran interessiert?
Ich habe selbst zu Aids noch nicht geforscht, mich aber intensiv mit Pflegegeschichte beschäftigt. In der Vorbereitung fiel mir auf, dass es zwar viel über HIV-Prävention gibt – was für sich genommen ja auch ein interessantes Thema ist. Man weiß aber relativ wenig darüber, wie im Gesundheitswesen, insbesondere in der Pflege, mit den erkrankten Menschen umgegangen wurde.
Michael Jähme forscht einerseits zur Aids-Geschichte in Köln, zum anderen stand er den Studierenden als Aids-Aktivist und langjähriger Aidshilfe-Mitarbeiter auch als Zeitzeuge zur Verfügung.
Im Seminar sollte auch geübt werden, mit Quellen umzugehen. Manche Arbeitsgruppen werteten klassische Quellen wie Publikationen aus, andere untersuchten etwa Comics zu Aids. Neben Michael Jähme konnten aber auch weitere Zeitzeug*innen befragt werden – zum Beispiel eine medizinische Fachangestellte, die bereits zu Beginn der Aidskrise in ihrer Praxis mit HIV-Patient*innen zu tun hatte. Dieses Gespräch war unter anderem deshalb sehr interessant, weil es deutlich machte, dass es häufig einzelne Akteur*innen im Gesundheitssystem waren, die sich unmittelbar für die Patient*innen eingesetzt und Veränderungen angestoßen haben. Denn das Gesamtsystem braucht erfahrungsgemäß immer erst Zeit, um auf neue Herausforderungen zu reagieren.
Eine andere Studierendengruppe hat sich mit einem bereits geführten und online im European HIV/AIDS Archive verfügbaren Interview auseinandergesetzt: ein Gespräch mit der Berliner Pfarrerin Dorothea Strauß über den Umgang der evangelischen Kirche mit dem Thema Aids.
Welches Vorwissen zu HIV, Aids und zur Aids-Geschichte brachten die Studierenden mit?
HIV und Aids waren bei fast allen in der Schule Thema – im Biologie- oder Sexualkundeunterricht. Tiefgehendes Wissen insbesondere über die historischen und soziologischen Aspekte der Krankheit hatte jedoch kaum jemand.
Gab es dadurch besondere Aha-Momente bei den Studierenden?
Eine ganze Reihe sogar. Beispielsweise der politische Kontext der Aidskrise – etwa der Streit zwischen der damaligen Gesundheitsministerin Rita Süssmuth und dem bayerischen Innenstaatssekretär Peter Gauweiler über den richtigen Weg der Aufklärung und Prävention. Letztlich ging es also um die Frage, wie man mit HIV-Positiven und Erkrankten umgeht. Dass derart restriktive Maßnahmen nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt wurden, hat manche doch sehr bestürzt.
Nicole Kramer[Studierende merken], dass die queeren Aktivist*innen heute gewissermaßen auf den Schultern dieser Vorgängergeneration stehen, die mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen hatte.
Durch die Zeitzeug*innengespräche veränderte sich außerdem der Eindruck, Aids sei ausschließlich ein Thema schwuler Männer. Es wurde deutlich, dass auch andere besonders betroffene Gruppen existieren, die sonst eher im Hintergrund stehen. Überraschend war für einige, welche Rolle Frauen in der HIV-Selbsthilfe sowie in der Versorgung von Menschen mit HIV und Aids gespielt haben.
Die Begegnung mit Michael Jähme und seinen Forschungen zur Entstehung der Aidshilfebewegung war insbesondere für Studierende aus dem Bereich Queer Studies sehr eindrücklich. Eine Person merkte anschließend im Gespräch an, dass die queeren Aktivist*innen heute gewissermaßen auf den Schultern dieser Vorgängergeneration stehen, die mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen hatte.
Wie gut ist aus Ihrer Sicht die Aids-Geschichte bislang wissenschaftlich aufgearbeitet?
Es gibt eine wachsende, aber noch überschaubare Zahl an Studien, vor allem zur politischen und medizinischen Dimension. Henning Tümmers („AIDS: Autopsie einer Bedrohung im geteilten Deutschland“) und Sebastian Haus-Rybicki („Eine Seuche regieren. AIDS-Prävention in der Bundesrepublik 1981–1995“) haben mit ihren Arbeiten dabei Pionierarbeit geleistet.
Nicole KramerIn Deutschland entstehen aktuell einige Arbeiten, etwa zur Frage, wie die Ärzteschaft in der DDR mit Aids umgegangen ist oder wie während der Aidskrise lesbische Care-Arbeit eine Rolle spielte. In Polen widmet sich eine Dissertation dem Themenkomplex Prostitution und HIV.
Im englischsprachigen Raum, vor allem in Großbritannien und den USA, ist die Forschung weiter – dort gibt es auch ein starkes Interesse an emotionsgeschichtlichen und erinnerungskulturellen Fragen. In Deutschland entstehen aktuell allerdings einige Arbeiten, etwa zur Frage, wie die Ärzteschaft in der DDR mit Aids umgegangen ist oder inwieweit während der Aidskrise lesbische Care-Arbeit eine Rolle spielte. In Polen widmet sich eine Dissertation dem Themenkomplex Prostitution und HIV – ebenfalls aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive. Diese neuen Forschungsansätze möchten wir gerne 2026/2027 auf einer gemeinsamen Tagung mit der Medizinischen Hochschule Hannover vorstellen. Wir hoffen nun, dass unsere Förderanträge dafür bewilligt werden.
Welche Forschungslücken sehen Sie noch?
Ich fände es spannend, persönliche Lebensgeschichten systematischer zu untersuchen: Wie haben sich zum Beispiel Familien von an Aids Erkrankten verhalten? Welche Rolle spielten Freundeskreise und Wahlfamilien bei der Pflege?
Außerdem konzentriert sich die Forschung bislang stark auf die Frühphase der Aidskrise, also auf die 1980er und frühen 1990er Jahre. Die Zeit danach wird kaum untersucht. Dabei ist gerade die Langzeitperspektive interessant: Wie haben sich Biografien von Menschen mit HIV verändert, seit die Infektion behandelbar ist? Welche gesellschaftlichen Folgen hatte dieser Wandel – etwa für verschiedene Generationen schwuler Männer?
An potenziellen Forschungsthemen im Kontext von HIV und Aids mangelt es keineswegs – und viele davon lassen sich eng mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen verknüpfen.
Mehr zum Thema Aidsgeschichte
Diesen Beitrag teilen