Die Überlebende

Wie lange der Beginn der HIV-Epidemie bereits zurückliegt, zeigt sich im neu entstandenen Interesse an dieser ersten, von Panik, Sterben und Wut begleiteten Periode der Aidskrise. Deren gesellschaftliche und gesundheitspolitische Auswirkungen haben das Interesse einer jungen Generation von Wissenschaftler_innen geweckt.
Und auch literarisch wird die Aidskrise wieder verstärkt thematisiert, zuletzt etwa von Joseph Cassara mit seinem Roman „Das Haus der unfassbar Schönen“ und in Carol Rifka Brunts „Sag den Wölfen, ich bin zu Hause“. Doch anders als in den Romanen, die vor der Jahrtausendwende erschienen, sind es nun vor allem Autor_innen, die in diese Ära gewissermaßen hineingeboren wurden und sie als Teil ihrer Kindheit und Jugend erlebten. Der erste Aidstote, den Rebecca Makkai bewusst wahrnahm, war daher nicht Rock Hudson oder Freddie Mercury, sondern bezeichnenderweise der Songtexter Howard Ashman, dem 1991 posthum ein Oscar für „Beauty and the Beast“ verliehen wurde.
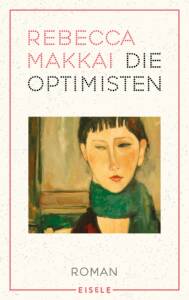
Mit dem Songwriter von Disney-Zeichentrick-Musicals wie „Little Mermaid“ und „Aladdin“ betrauerte die damals zwölfjährige Makkai erstmals jemanden, dessen Werk für sie eine große Bedeutung hatte und der an den Folgen der Immunschwäche gestorben war.
Beginn der Aidskrise
Dass Makkai sich mit Anfang 40 in die Mitte der Achtzigerjahre zurückversetzt und in einem Roman die Auswirkungen der Aidskrise auf die Schwulenszene ihrer Heimatstadt Chicago ausleuchtet, ist also durchaus überraschend. Was eigentlich nur als Nebenschauplatz geplant war, hat sich, wie die Autorin in Interviews erzählt, schließlich zur zentralen Geschichte entwickelt.
„Die Optimisten“ setzt im Jahr 1985 ein, als Aids auch die Metropole im Mittleren Westen der USA erreicht hat. Weil Nicos Freunde und dessen Lebenspartner durch die Familie von der offiziellen Trauerfeier ausgeschlossen wurden, nehmen sie zeitgleich mit einer eigenen Gedenkveranstaltung von ihm Abschied. Und mit ihnen Nicos jüngere Schwester Fiona.
Für sie ist der schwule Freundeskreis ihres Bruders längst zur Wahlfamilie geworden: Nicos Lebensgefährte Terrence etwa, der bald ebenso infolge von Aids sterben wird, oder auch der Geschäftsmann Charlie, der mit seinen Gewinnen ein alternatives Szene-Stadtmagazin finanziert, und dessen Partner Yale. Trotz mancher Krisen hält das Paar zusammen und hofft, in einer monogamen Beziehung vor dem Virus verschont zu bleiben. Durch die Vermittlung von Fiona steht Yale, der für eine Kunstsammlung der Universität Spenden sammelt, zudem beruflich vor einem Coup.
Nora, in den 20er-Jahren Model und Muse der Pariser Kunstbohème, will ihre bislang unbekannte Sammlung stiften. Doch dann reißt die Nachricht, dass Charlie sich bei einem Seitensprung infiziert hat, alle vermeintlichen Sicherheiten ein.
Rebecca Makkai verfolgt mit „Die Optimisten“ nicht den Anspruch einer umfassenden Chronik der Aids-Ära – sie versteht sich in erster Linie als Erzählerin. Wie die US-Regierung, die Bevölkerung und die Communitys auf die neue Krankheit reagieren, dient ihr zunächst nur als Hintergrund für eine komplexe Geschichte über verlorene Lieben, Verantwortung, Schuld, Zeugenschaft und Erinnerung.
Authentisch und fundiert recherchiert
„Die Optimisten“ ist also keineswegs ein dokumentarischer Aidsroman, doch gleichwohl fundiert recherchiert. Mehrere Seiten umfassen die Danksagungen am Ende ihres Buches. In den Archiven der LGBT-Community und schwulen Zeitschriften hat sie Fakten recherchiert, um ein lebendiges Bild von „Boystown“ zu zeichnen, wie Chicagos schwuler Stadtteil Lakeview umgangssprachlich genannt wird.
Wenn nicht dokumentarisch, so zeichnet sie das Gesamtbild doch sehr authentisch. Vor allem durch die fast beiläufig eingestreuten Details, mit denen sie das Denken, Fühlen, Zweifeln, Kämpfen und Trauern, aber auch die Debatten in der Community einfängt – gespeist aus vielen Stunden Gespräch mit Zeug_innen und Aktivist_innen.
„Bescheid zu wissen war, in manchen Fällen, ein Segen“
Rebecca Makkai gelingt es dadurch, die Atmosphäre einer Zeit lebendig werden zu lassen, als die Informationen zu HIV noch lückenhaft, die Vorurteile und Ängste umso größer waren. Als erstmals ein zuverlässiger Test zur Verfügung steht, aber noch lange keine Behandlung. „Die Tatsache, dass Fieber einfach nur Fieber sein konnte, Husten einfach nur Husten, ein Ausschlag einfach nur ein Ausschlag – sie war ein Geschenk, das der Test ihnen gemacht hatte. […] Bescheid zu wissen, war in manchen Fällen ein Segen.“ Makkai erzählt aber auch, weshalb es zum Fluch werden konnte.
Zusammentragen von Erinnerungen
Die sozialen Verwerfungen, die die Aidskrise auch innerhalb der schwulen Communitys auslöst bzw. verstärkt, verfolgt Makkai zwar nicht tiefergehend, aber es genügen ihr wenige knapp skizzierte Beispiele, um etwa aufzuzeigen, wie das ohnehin schon fragile US-Gesundheitssystem vielen Aidskranken selbst die Chance auf eine menschenwürdige Pflege nimmt.
Ein ganzes, sehr intensives Kapitel lang nimmt Makkai ihre Leser_innen mit zur einzigen großen ACT-UP-Demonstration, die Chicago 1990 erlebt hat, um Nachgeborenen auch diese Seite der Aidskrise verständlich zu machen: wie Angst und Trauer sich in Wut, Protest und Aktionismus verwandeln. Nicht nur die ACT-UP-Demo als solche muss bei Rebecca Makkai großen Eindruck hinterlassen haben, sondern auch, dass das Ergebnis selbst in Chicago fast vergessen und kaum dokumentiert ist. Anlässlich des 30. Jahrestags im April 2020 hat sie deshalb für das „Chicago Magazin“ die Erinnerungen von zehn Demoteilnehmer_innen zusammengetragen.“
„Sie trauern nicht. Sie sehen die leeren Stellen nicht“
Traumata und alte Wunden
Erinnerungen, aber auch Traumata sind die zentralen Leitmotive in der zweiten Zeitebene von „Die Optimisten“. Dieser Handlungsstrang spielt 2015. Fiona, mittlerweile 50, ist in Paris auf der Suche nach ihrer Tochter, die den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Auch Richard, ihr inzwischen betagter Freund aus alten Chicagoer Tagen, ist in der Stadt. Aus dem jungen Szenefotografen ist inzwischen ein weltberühmter Künstler geworden. Die Werkschau, die man ihm in Paris widmet, wird zum großen Finale des Romans, in dem einige der zentralen Figuren nicht nur auf Fotografien wieder in Erscheinung treten, sondern auch leibhaftig.
Wie Makkai Schicksale und Motive miteinander verknüpft, mag bisweilen etwas überambitioniert wirken. Den Anschlag auf die Pariser Konzerthalle Bataclan 2015 hätte es als dramatischen Katalysator beispielsweise nicht unbedingt gebraucht. Interessanter ist hingegen, wie sie durch die Figur Nora eine Verbindung zur „Verlorenen Generation“ herstellt. Also eine Verbindung zwischen der Generation, die während und nach dem Ersten Weltkrieg aufgewachsen ist, und jener, die die Aidskrise durchlitten hat.
Fiona hat sich vom Trauma dieser Jahre nicht wirklich befreit. Zu viele ihrer Freunde hat sie krank werden und sterben sehen, einige bis zuletzt gepflegt. Sie ist eine Überlebende, die ihre Familie verloren hat. „Um einen herum sind all diese glücklichen Menschen und man merkt: Nein, sie trauern nicht. Sie sehen die leeren Stellen nicht.“
„Wie sollte sie ihnen erklären, dass diese Stadt ein Friedhof war?“
Zu dieser Trauer und Einsamkeit drängen sich Schuldgefühle. „Sie wünschte, sie hätte einige von ihnen überredet, sich früher testen zu lassen, wünschte, […] sie hätte für einige von ihnen mehr getan, als sie krank wurden.“ Vor allem merkt sie, dass sie diese Empfindungen mit kaum jemandem mehr teilen oder anderen verständlich machen könnte. „Wie sollte sie ihnen erklären, dass diese Stadt ein Friedhof war? Dass sie jeden Tag durch Straßen liefen, wo […] ein Massenmord der Gleichgültigkeit und Antipathie [stattgefunden hatte]“.
Ein Roman für ein breiteres Publikum
Die zitierte Stelle ist übrigens eine der wenigen, in denen Makkai allzu plakativ und mit grenzwertigen Bildern arbeitet. Denn auch wenn Makkai ansonsten ihre Leser_innenschaft am Schicksal ihrer Figuren intensiv teilhaben lässt und emotional mitzunehmen weiß – ihre Momentaufnahmen aus dem Krankenhausalltag oder vom sozialen und familiären Elend, das manche Aidserkrankte durchleiden, schildert Rebecca Makkai betont nüchtern.
Ihr deutscher Verlag wirbt mit Zitaten aus der US-Presse: „Ein Pageturner“ (New York Times Book Review), „Fesselnd. Spannend, wunderschön“ (The Boston Globe). Wertungen, die mancher für einen Roman über Aids eher unpassend bis vernichtend erachten könnten. Ja, „Die Optimisten“ ist ein Schmöker, mit einer unprätentiösen Sprache und konventionell erzählt, der es sicherlich auch deshalb in die „New York Times“-Beststellerliste geschafft hat und nun sogar als Fernsehserie adaptiert werden soll. Dadurch erreicht der Roman zugleich ein Publikum, das sich auf diesem Weg vielleicht zum ersten Mal intensiver mit vielen Aspekten der Aidskrise auseinandersetzt.
Rebecca Makkai „Die Optimisten“. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Bettina Abarbanell. Eisele Verlag, 624 Seiten, gebunden, 24 Euro.
Diesen Beitrag teilen



