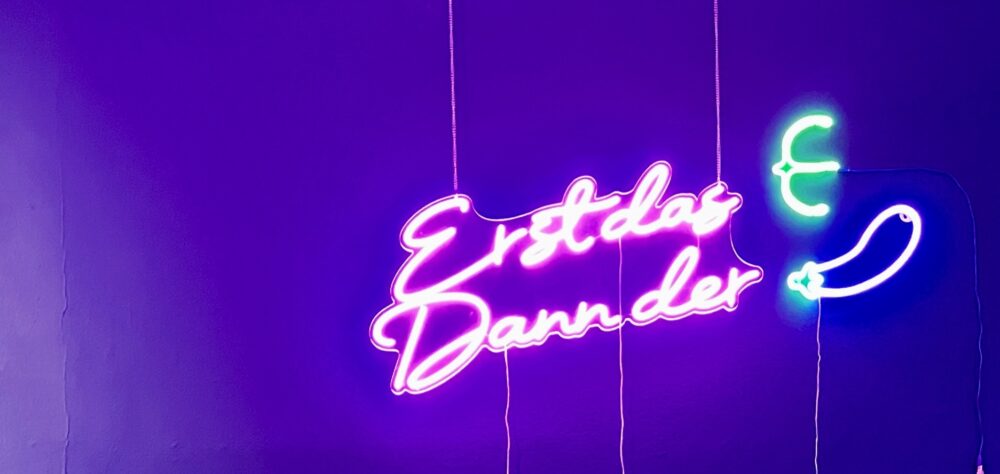Aufstand der Huren

Der Internationale Hurentag erinnert an eine legendäre Protestaktion vor 50 Jahren: Ab dem 2. Juni 1975 sorgten Sexarbeiter*innen durch die Besetzung der Kirche Saint-Nizier in Lyon und einen Streik weltweit für Schlagzeilen. Weltweit demonstrieren seither an diesem Tag Sexarbeitende gegen Gewalt und Diskriminierung.
Die Wut der Sexabeiter*innen auf den Staat, die Polizei und die Behörden hatte sich über viele Jahre angestaut. Bordelle hatte man in Frankreich schon vor langer Zeit abgeschafft, auch die Prostitution war offiziell verboten, aber keineswegs verschwunden – trotz drohender Geld- und Gefängnisstrafen.
Die Folge: Sexarbeit fand gänzlich im Untergrund statt, und die Sexarbeitenden waren schutzlos Gewalttaten ausgeliefert. Zwei Morde an Sexarbeiter*innen zum Jahreswechsel 1974/75 versetzten die Kolleg*innen ein weiteres Mal in Angst und Schrecken – und wurden zu einer Initialzündung.
Die Sexarbeiter*innen begannen sich zu organisieren, einen Forderungskatalog zu erstellen und auf die unerträglich gewordenen Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Während über viele Jahre das Prostitutionsverbot in den meisten Städten recht lax gehandhabt worden war, hatte sich die Lage seit Anfang der 1970er-Jahre verändert, besonders drastisch in Lyon.
Polizeiliche Verfolgungsjagden
Die Polizei unternahm regelrechte Verfolgungsjagden auf Sexarbeiter*innen, die man mit Bußgeldern wegen „zur Unzucht aufforderndem Verhalten“ belegte. Bei mehrfacher Verurteilung drohte eine Haftstrafe. Zum anderen wurden rückwirkend Steuerbescheide auf ein exorbitant hoch geschätztes Einkommen erteilt. Das alles wollten sich die Sexarbeiter*innen nicht länger gefallen lassen.

Als im Februar 1975 vor dem Polizeipräsidium in Marseille Sexarbeiter*innen für ihre Rechte, den Zugang zur Sozialversicherung und gegen Polizeischikane demonstrierten, war das zwar neu und außergewöhnlich, doch der Protest blieb folgenlos. Die Protestierenden aber gaben nicht auf.
Es bedurfte offensichtlich einer spektakuläreren Aktion, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Am Morgen des 2. Juni 1975 schmückten zwei Transparente die Fassade der Kirche Saint-Nizier in Lyon: „Hierher haben sich die Prostituierten von Lyon geflüchtet“ und „Unsere Kinder wollen nicht, dass ihre Mütter ins Gefängnis kommen“.
Sechzig Frauen hatten in einer Nacht- und Nebelaktion das gotische Bauwerk in der Altstadt kurzerhand für besetzt erklärt. Genau genommen suchten viele von ihnen Asyl, denn sie hatten wegen Verstoßes gegen das Prostitutionsverbot bereits Haftbefehle erhalten. Unter dem Slogan „Der Staat ist der größte Zuhälter“ forderten die Frauen deshalb die sofortige Aufhebung der Bußgeldbescheide wie auch der Haftstrafen.
Der Staat ist der größte Zuhälter
Die Frauen in Saint-Nizier gingen aber noch weiter: Sie riefen zum Streik aller Sexarbeiter*innen auf. „Die Prostituierten sind die am stärksten unterdrückten, am meisten gehassten und verfolgten aller Frauen. Heutzutage sind sie auch die Bewusstesten und die am stärksten Kämpfenden“, erklärte Kate, eine der Besetzerinnen.
Der Streik sei eine klare und direkte Antwort auf die Lebensbedingungen von Sexarbeitenden: auf die Quälereien seitens der Polizei, auf die Heuchelei der Gesellschaft, die sexuelle Unterdrückung, die Ausbeutung der Frau und die Erpressung. „Der Kampf aller Frauen hat seinen Anfang genommen, und er beginnt hier. Das Beste wird noch kommen!“, verkündete Kate. Und sie sollte recht behalten.
Denn nicht nur, dass die Frauen unerwartet Unterstützung durch die Kirche erfuhren. Ihre Aktion schlug hohe mediale Wellen, sogar international, und sie erlebten Solidaritätsbekundungen aus weiten Teilen der Bevölkerung. Vor allem aber schlossen sich immer mehr Kolleg*innen an. Aus den zunächst 60 Protestierenden wurden 100 und schließlich über 170; und der Streik dehnte sich von Lyon auch auf andere Städte wie Paris, Grenoble und Marseille aus.
Der Kampf aller Frauen hat seinen Anfang genommen, und er beginnt hier
Acht Tage lang beherrschten die Besetzer*innen von Lyon die Schlagzeilen und wurden durch die Aktion von vielen zum ersten Mal jenseits der üblichen Klischees und Vorurteile als Berufstätige, als Mütter und schlicht als Menschen wahrgenommen. Als Sexarbeiter*innen, die nicht mehr forderten als ihre Menschenwürde und die ihnen zustehenden staatsbürgerlichen Rechte.
„Wenn die Gesellschaft weiterhin sagt ‚Prostituierte müssen sein’, dann ist es ungerecht, dass sie die Frauen, die sie dafür braucht, wie Verbrecherinnen behandelt, zusammenschlagen und einsperren lässt“, schreiben die Besetzer*innen in einem offenen Brief an den französischen Staatspräsidenten Giscard d’Estaing. „Sie sind, wie Sie selbst erklärt haben, ‚Präsident aller Franzosen’. Also sind Sie auch Präsident der Prostituierten!“
In der Politik und den Polizeibehörden allerdings fanden die Protestierenden weder Gehör noch Verständnis. Am frühen Morgen des 10. Juni 1975 wurde die Kirche Saint-Nizier von der Polizei gewaltsam geräumt.
Die Ordnung war wiederhergestellt, der Aufstand beendet, die Sexarbeiter*innen in ihre Schranken gewiesen. Auf den ersten Blick hatten die Demonstrant*innen verloren, weil sie keine ihrer Forderungen durchsetzen können. Und dennoch war die Aktion ein Erfolg. Erstmals hatten sich Sexarbeiter*innen organisiert, sich Gehör verschafft und sich gemeinsam für ihre Rechte stark gemacht.

Der Prostituiertenstreik von Lyon ist daher für die Sexarbeiter*innen, was für die LGBTIQ*-Community weltweit die Stonewall-Unruhen in New York sind: der Gründungsmoment einer politischen Bewegung. In der queeren Bar Stonewall Inn hatten sich im Juni 1969 Schwule, Lesben und trans Personen erstmals gegen eine der willkürlichen Razzien gewehrt und sich eine Straßenschlacht mit der Polizei geliefert. Der Aufstand in der Christopher Street wird seither rund um den Globus mit CSD-Paraden gefeiert. Zur Erinnerung an die Ereignisse in Lyon wiederum haben 1976 Sexarbeiter*innen und ihre Organisationen den 2. Juni zum International Sexworkers’ Day erklärt.
Weltweit demonstrieren seither an diesem Tag Sexarbeitende aller Geschlechter gegen Unterdrückung und die Diskriminierung ihres Gewerbes. Seit 2001 ist der rote Regenschirm das Symbol dieser Bewegung. In Deutschland wurde der Internationale Hurentag erstmals 1989 ausgerufen.
Er trägt, wie die Aktivistin Mia Rose erklärt, den Kampf der Sexarbeitenden um ihre Rechte jährlich in die breitere Öffentlichkeit: „Sexarbeiter*innen sind Teil unserer Gesellschaft und fordern Respekt, Sicherheit und gleiche Rechte für sich und ihre Kolleg*innen ein.“
Mia RoseObwohl Sexarbeit in Deutschland erlaubt ist, gibt es viele Regeln, die ein legales und sicheres Arbeiten einschränken
Denn auch 50 Jahre nach der Kirchenbesetzung in Lyon erleben Sexarbeiter*innen ebenso in Deutschland Diskriminierung, Respektlosigkeit und Ungleichbehandlung. „Ein großes Thema ist weiterhin die Stigmatisierung. Viele Menschen haben Vorurteile gegenüber Sexarbeit. Das führt dazu, dass Sexarbeiter*innen oft ausgegrenzt werden – zum Beispiel von der Familie, von Ärzt*innen oder Vermieter*innen“, erklärt Mia Rose, die einige Jahre selbst als Sexarbeiter*in tätig war und sich weiterhin im Bereich der Selbsthilfe und Professionalisierung von Sexarbeitenden engagiert.
Sie macht noch ein weiteres Problem für ihre Kolleg*innen aus: die weiterhin bestehende rechtliche Unsicherheit. „Obwohl Sexarbeit in Deutschland erlaubt ist, gibt es viele Regeln, die ein legales und sicheres Arbeiten einschränken und teils nicht bundesweit einheitlich gelten. Oft bedeuten diese Regeln mehr Kontrolle und Druck – aber keine echte Hilfe“, sagt Mia Rose. „Zudem haben viele Sexarbeiter*innen keinen barrierefreien Zugang zu Gesundheitsversorgung oder Beratung. Manche trauen sich nicht, Hilfe zu suchen, weil sie Angst vor Diskriminierung oder Behörden haben.“
Dialograum Sexarbeit zum Jubiläum
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kirchenbesetzung von Saint-Nizier hat Mia Rose in Leipzig zusammen mit der dortigen Peterskirche, der Selbsthilfegruppe „family affair“ und der Gesellschaft für Sexarbeits- und Prostitutionsforschung (GSPF) das Bündnis „HURENAUFSTAND 1975“ gegründet. Gemeinsam werden sie vom 1. bis zum 4. Juni 2025 die Leipziger Peterskirche unter dem Motto „Huren im Hause des Herrn“ zu einem „Dialograum Sexarbeit“ umgestalten.
Vier Tage lang finden dann dort von 10 bis 21 Uhr Ausstellungen, Lesungen, Musik und Andachten sowie Gespräche mit Sexarbeitenden, Vorträge und Diskussionen statt. Unter anderem wird bei Einzelveranstaltungen die Situation von Eltern, von migrantischen bzw. trans* Personen in der Sexarbeit beleuchtet oder auch das Thema Menschenhandel und Sexarbeit behandelt. Die DAH-Referentin Eléonore Willems stellt die Ergebnisse der bundesweiten Studie „Was brauchen Sexarbeiter*innen?“ vor und die Sexarbeiter*in Roach berichtet davon, wie es, ist unter dem Nordischen Modell zu arbeiten.
Mehr zum Internationalen Hurentag
- Mehr über den „Dialograum Sexarbeit“ sowie ein Flyer mit dem ausführlichen Programm sind auf www.kirche-leipzig-sued.de.
- Interviews von 1975 mit Besetzerinnen der Kirche Saint-Nizier (Französisch mit englischen Untertiteln)
- Audio-Dokumentation zur Revolte in Lyon (France Culture, in französischer Sprache)
- Sexarbeit in Europa: Mehr Gesundheit durch Selbstorganisation und Partizipation
- Sexarbeit: Wider die Ausweitung der Verbotszone
Diesen Beitrag teilen