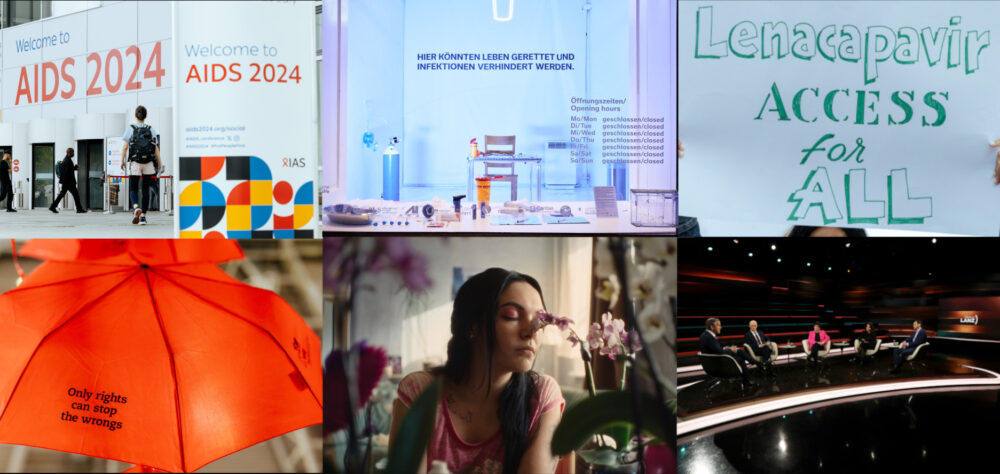Weniger Schmerzmittel, mehr Kaiserschnitte: Rassismus in der Geburtshilfe

Rassistische Zuschreibungen im Gesundheitssystem haben unter Umständen dramatische Folgen, berichtet N’joula Baryoh. Weiße Menschen in Deutschland denken noch heute, dass Schwarze Frauen besser gebären könnten und schmerzunempfindlicher seien. Baryoh ist Gynäkologin und Dozentin/Referentin für Rassismuskritik in der Medizin sowie engagiert bei Black in Medicine, einem Netzwerk Schwarzer Mediziner*innen. Ulrike Wagener sprach mit ihr über Rassismus in der Geburtshilfe und Gynäkologie.
Gefährliche Stereotype
In der Antidiskriminierungsberatung der Aidshilfe erfahren Berater*innen immer wieder, dass Schwarzen Frauen mit HIV in der Schwangerschaft viel Misstrauen begegnet. Ihnen wird unterstellt, dass sie ihre Medikamente nicht regelmäßig nehmen oder „sowieso stillen“. Wundert Sie das?
Das wundert mich ganz und gar nicht, weil das Gesundheitssystem keine Ausnahme darstellt und wir auch hier immer wieder Diskriminierung und anti-Schwarzen Rassismus sehen und erleben. Es wird oft angenommen, Schwarze Menschen seien nicht wirklich mündig und imstande, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, die gesundheitsfördernd sind. Dem liegt eine generelle Voreingenommenheit zugrunde, die darin begründet ist, wie Schwarze Menschen oder Menschen afrikanischer Herkunft generell gesehen werden.
Woran zeigt sich das noch in der Gynäkologie und Geburtshilfe?
Wenn wir an Stereotype denken, dann sind das so Sprüche wie „Schwarze Frauen gebären schnell“, „Schwarze Frauen haben weniger Schmerzen“ oder „Afrikanische Frauen können alle gut stillen, die kriegen ja dauernd Kinder“. Das sind alles keine Dinge, die ich aus dem Ärmel schüttele, sondern die mir oder Kolleg*innen, sowohl als Fachpersonal als auch als Patientinnen, so begegnet sind. Dieses leider bis heute verbreitete Gedankengut ist begründet im Kolonialismus, weil die Medizin unter anderem in pseudowissenschaftlichen Studien und Ergebnissen aus dieser Zeit begründet ist. Wir erleben auch, dass nicht differenziert wird: Ist das eine Person, die vom Kontinent kommt, die vielleicht eine Migrationsbiografie hat und der deutschen Sprache nicht mächtig ist? Oder ist das eine Person, die einen deutschen Hintergrund hat und schon hier verwurzelt, hier aufgewachsen ist?
N’joula BaryohEs wird nicht differenziert: Ist das eine Person, die eine Migrationsbiografie hat und der deutschen Sprache nicht mächtig ist? Oder ist das eine Person, die einen deutschen Hintergrund hat und hier verwurzelt ist?
Welche Folgen haben rassistische Zuschreibungen für die Patient*innen?
Das hat unter Umständen dramatische Folgen. Laut der Studie „Being Black in Europe“ gab es in Österreich und Deutschland europaweit am meisten rassistische Diskriminierung beim Zugang zum Gesundheitssystem. Auch aus Untersuchungen wie dem Afrozensus oder dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor wissen wir, dass Schwarze Menschen eine schlechtere medizinische Behandlung und Therapie bekommen. Das ist ein strukturelles Problem. Erhebungen aus dem angelsächsischen Raum zeigen ganz klar einen Zusammenhang zwischen „Race“ und dem Ausgang einer Geburt: In den USA und Großbritannien ist das Risiko bei oder nach der Geburt zu sterben für Schwarze Frauen zwei- bis dreimal so hoch wie für weiße Frauen, ähnlich sieht es bei der Säuglingssterblichkeit aus. Meine Erfahrung und die von Kolleg*innen zeigt, dass Schwarze Frauen, insbesondere mit Sprachbarriere, bei ersten Anzeichen oder Auftreten von Komplikationen bei einer vaginalen Geburt viel häufiger einen Kaiserschnitt bekommen. Das deckt sich auch mit Studien aus den USA, nach denen bei Schwarzen Frauen eine 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für einen ungeplanten Kaiserschnitt besteht als bei weißen Frauen (Quelle).
N’joula BaryohSchwarze Frauen, insbesondere mit Sprachbarriere, bekommen bei ersten Anzeichen von Komplikationen viel häufiger einen Kaiserschnitt.
Schwarze Frauen bekommen weniger Schmerzmittel verschrieben, weil sie als „schmerzresistent“ gelten. Und sie bekommen weniger Unterstützung nach der Geburt, zum Beispiel beim Stillen, wenn davon ausgegangen wird, dass diese Personengruppe doch viel besser entbindet und stillt. Und es gibt ganz drastische Folgen von Gaslighting. Betroffene schildern, dass ihre Sorgen und Nöte nicht ernst genommen oder bagatellisiert werden. Auf Black in Medicine berichtet eine Betroffenen, dass nicht ernst genommen wurde, als sie abnehmende Kindsbewegungen schilderte und dann ein paar Tage später das ungeborene Kind tot war.
Obwohl es mittlerweile als Standard gilt, dass HIV-positive Frauen stillen können, wenn die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, wird das im Krankenhaus nicht immer so gehandhabt. Können Sie etwas dazu sagen, wie das bei Schwarzen Frauen mit HIV aussieht?
Ich denke, das ist oftmals Unwissen, das generell diese Erkrankung betrifft. Bei Schwarzen Frauen mit HIV kommen andere Vorurteile hinzu, wie z. B. „das sind alles Sexworker*innen“ oder „die sind ja so promiskuitiv“. Aber bezüglich des Stillens sind das generelle Vorteile, die mit dem Stigma der Grunderkrankung einhergehen.
Sie haben Daten aus Großbritannien und den USA angeführt. Das ist dem geschuldet, dass im deutschen Gesundheitswesen Daten über die ethnische Herkunft nicht erhoben werden. Wenn überhaupt wird der Migrationshintergrund erhoben, der allein sagt aber noch nichts über rassistische Diskriminierung aus. Müsste sich das ändern?
Ich glaube, dem liegen auch wirtschaftliche Faktoren zugrunde. In Deutschland stellen Schwarze Menschen mit knapp über einer Million Personen eine vermeintlich kleine Gruppe dar. Somit gibt es auch kein großes Interesse, solche Daten zu erheben. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind und wir möchten, dass alle Menschen ein Anrecht auf eine gleichwertige Behandlung haben, dann ist es unabdingbar solche Daten zu erheben.
Koloniale Kontinuitäten
Sie haben die kolonialen Kontinuitäten von Rassismus in der Geburtshilfe und Gesundheitsversorgung angesprochen. Können Sie das erläutern?
Ich finde es wichtig, bei dieser Debatte im deutschsprachigen Raum zu bleiben, denn oftmals geht es dann schnell weiter nach Europa oder über den Atlantik. Als würde die Geschichtsschreibung auf Deutschland bezogen erst mit dem Dritten Reich beginnen. Aber Deutschland war auch eine Kolonialmacht und hatte Kolonien im heutigen Ghana, Namibia, Togo und anderen Staaten. Und es gab einige Tropenmediziner und Eugeniker, die in Afrika waren und dort an Schwarzen Menschen Experimente vorgenommen haben.
Die Pseudowissenschaft der „Rassentheorie“ war sehr verbreitet in der Gesellschaft, aber eben auch in der Lehre der Universitäten. Wenn ich davon ausgehe, dass Schwarze Menschen keine Menschen sind und keine Empfindungen haben, dann kann das als Rechtfertigung dafür dienen, sie wirtschaftlich oder für medizinische Versuche auszubeuten.
Robert Koch hat beispielsweise in der Kolonie Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Burundi und Ruanda) Menschen in sogenannten Konzentrationslagern isoliert und ein arsenhaltiges Mittel verabreicht, das in Deutschland zu seiner Zeit schon verboten war, um ein Medikament für die Schlafkrankheit zu finden. Und wenn wir auf die Gynäkologie schauen, gab es auch hier Beispiele: 1937 wurden in Deutschland Kinder, die ein Schwarzes, afrikanisches und ein weißes Elternteil hatten, brutal zwangssterilisiert, um die Reinheit der weißen „Rasse” beizubehalten. Diese Dinge sind also nicht weit weg von uns.
Inwiefern wirkt das heute noch?
Wir müssen uns bewusstmachen, dass viele der Menschen, die dieses Gedankengut hatten, dies in ihren Büchern, in ihren Theorien und ihrer Lehre verbreitet haben, auch nach dem Ende des Dritten Reiches, ob im Familiengefüge oder im Beruf. Wenn man damals dachte, dass Schwarze Menschen besser gebaut seien für physische Arbeit und Schmerz besser ertragen können, dann liegt es nahe, dass weiße Menschen in Deutschland heute denken, dass Schwarze Frauen besser entbinden könnten und schmerzunempfindlicher seien. Noch 2015 dachte die Hälfte der Medizinstudierenden nach einer US-Studie, dass es biologische Unterschiede zwischen weißen und Schwarzen Patient*innen gäbe, die einer angeblichen geringeren Schmerzempfindlichkeit der Schwarzen Patient*innen zugrunde lägen (Quelle). Wobei 14 % dieser Gruppe dachten, dass Schwarze Menschen zum Beispiel weniger sensitive Nervenendungen hätten. Das ist doch ein klares Beispiel die für koloniale Kontinuität dieser Falschtheorie.
Im März finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt, wo auch Projekte wie das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teilnehmen. Dieses Jahr ist das Motto: „Menschenwürde schützen“. Wollen Sie sagen, was Sie sich dazu wünschen?
Dazu kann und möchte ich gar nichts sagen – insbesondere angesichts der momentanen politischen Lage. Ich weiß nicht, wer sich diese Motti ausdenkt, aber das ist eher der blanke Hohn, wenn wir uns global oder auch innenpolitisch in Deutschland anschauen, wo die Reise schon hingegangen ist und wohin sie vermutlich weitergehen wird.
N’joula BaryohIch wünsche mir weniger Lethargie von weißen Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, ganzjähriges Engagement und Courage.
Ich finde es immer noch wichtig, dass diese Erinnerungs- und Sensibilisierungskultur stattfindet: im Februar der Black History Month und im März dann die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Aber man darf auch verstehen, dass viele Menschen, die rassifiziert oder marginalisiert sind und werden,– freundlich ausgedrückt – nur müde schmunzeln darüber. Ich wünsche mir generell weniger Lethargie von weißen Menschen, die nicht von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, ganzjähriges Engagement und Courage eben. Dass sie fernab von solchen Wochen oder Tagen an ihre Empathie, an ihr Menschsein anknüpfen und versuchen, verständnisvoller und wertschätzender mit anderen Menschen umzugehen, egal wo diese herkommen.
Mehr zu Rassismus im Gesundheitssystem
Diesen Beitrag teilen