„Antirassistische Arbeit muss 365 Tage im Jahr passieren“

Seit 1966 ist der 21. März, ausgerufen durch die UNO, ein Gedenktag gegen Rassismus. Aus diesem Anlass sprachen wir mit Dr. Pum Kommattam von der Lesbenberatung Berlin/LesMigraS über Mehrfachdiskriminierung, trans* Menschen of Color, strukturelle HIV-Prävention und strukturellen Rassismus.
Pum, mit welchen Zielgruppen arbeitet ihr in der Lesbenberatung?
Historisch gesehen umfassen unsere Zielgruppen vor allem lesbische Frauen. Das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten hin zu verschiedensten queeren Frauen und auch sehr vielen trans* Menschen mit und ohne Flucht- und/oder Migrationsgeschichte erweitert.
LesMigraS, der Antigewalt- und Antidiskriminierungs-Bereich der Lesbenberatung Berlin, arbeitet sehr viel zum Thema Mehrfachdiskriminierung bzw. Intersektionalität. Wie sieht das zum Beispiel in der Arbeit mit Trans* of Color aus, wie können wir uns das vorstellen?
Ungefähr so: Verschiedene Formen von Diskriminierung verlaufen nicht nebeneinander her und können auch nicht eins und eins zusammengezählt werden. Es sind die Schnittstellen verschiedener Diskriminierungen, die zu sehr erschwerten Lebensrealitäten für unsere Klientel führen können.
Eine weiße, cisgeschlechtliche schwule Person zum Beispiel wird wissen, was Vorurteile sind, im familiären Kontext, auf der Arbeit oder sonst wo. Diese Diskriminierungserfahrungen können die Gesundheit, das Wohlbefinden und auch das Sicherheitsgefühl dieser Person beeinflussen.
Sexualität kann man verstecken. Bestimmte andere Dimensionen nicht
In diesem Beispiel geht es aber lediglich um eine Dimension, nämlich Sexualität. Sexualität kannst du bei Bedarf verstecken, was nicht ideal ist, aber im Notfall könntest du einfach vorgeben, heterosexuell zu sein. Du hast dadurch die Möglichkeit, dir bestimmte Diskriminierungserfahrungen zu ersparen.
Bestimmte Dimensionen kann man aber nicht verstecken. Eine trans* Frau of Color zum Beispiel, die zu Unrecht als Mann gelesen wird, wird, egal ob sie einkaufen, aufs Klo, oder zur Arbeit geht, als trans* Frau sichtbar sein. Das heißt, dass sie immer und überall in diesen Kontexten mit Vorurteilen und Ablehnung rechnen muss. Hinzu kommen in diesem Fall rassistische Vorurteile. Egal, in welchem Kontext du bist.
Das heißt, anders als die Sexualität beim cisschwulen Mann aus dem ersten Beispiel ist trans* teilweise, Hautfarbe aber immer ein Teilaspekt, den du nicht verstecken kannst.
Wenn die Vorurteile, die Menschen auf Basis von Hautfarbe haben, mit den Vorurteilen, die Menschen auf Basis von Geschlecht haben, kollidieren, kann dies dazu führen, dass betroffene Personen wenig bis keine Anlaufstellen haben, in denen sie sich sicher fühlen.
Die LGBTIQ+-Organisation ist weiß dominiert, also erfährst du dort Rassismus. Und der Kulturverein, in dem deine Muttersprache gesprochen wird, ist in Bezug auf dein Geschlecht oder deine Sexualität – wie die meisten andere Vereine – nicht sensibilisiert genug.
Da bedeutet konkret, dass viele Leute, die Mehrfachdiskriminierung erfahren, sich in Nischen verstecken oder zurückziehen müssen, um sicher zu sein.
Wenn wir an Menschenrechte glauben, dann wissen wir spätestens hier, dass wir gescheitert sind.
Wir möchten nicht, dass Leute auf Basis von Geschlecht, Hautfarbe, Körpereigenschaften oder sonst was diskriminiert werden. Sie werden es aber. Seit langer Zeit.
Ich führe dieses Interview für das magazin.hiv der Deutschen Aidshilfe. Hast du Ideen oder Vorstellungen, wie Aidshilfen intersektionaler arbeiten können?
Was HIV-Stigma angeht, ist in den letzten Jahrzehnten viel passiert, und ich nehme gern verschiedenste Aidshilfen als Beispiel dafür, denn im Vergleich zu dem Stigma und der Unwissenheit von vor 30, fast 40 Jahren sind wir wirklich in einem anderen Jahrhundert angekommen. Nicht nur zahlentechnisch, sondern auch lebensrealitätstechnisch.
Das heißt, auf individueller Ebene ist da sehr viel passiert, und ich habe viel Respekt vor dieser Bewegung, was ein Kompliment an alle Aidshilfen ist.
Die Deutsche Aidshilfe hat viel Angst abgebaut und Informationen auf elegante und intelligente Art und Weise kommuniziert.
Die Aidshilfen haben viel erreicht. Aber in der Regel geht es nur um eine Stigmatisierung, die in Bezug auf HIV
Das fängt an bei Grafiken, geht über die Website bis hin zu Give-aways. Es ist so gut durchdacht, dass ich den Leuten teilweise Flugküsschen zuschmeiße in Gedanken.
In der Regel geht es dabei aber nur um eine Stigmatisierung, nämlich die auf der Basis von HIV.
Und hier haben die Aidshilfen genau die gleiche Herausforderung wie eigentlich jede andere Institution auch.
Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass Intersektionalität noch nicht überall angekommen ist oder falsch ankommt.
Für die meisten Organisationen besteht die Krux in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, der Aufarbeitung der eigenen Gegenwart und der Aufarbeitung von bestehenden Ungerechtigkeiten innerhalb der eigenen Organisation. Das ist kein einfacher und auch kein schnell gemachter Prozess, aber weit entfernt von unmöglich.
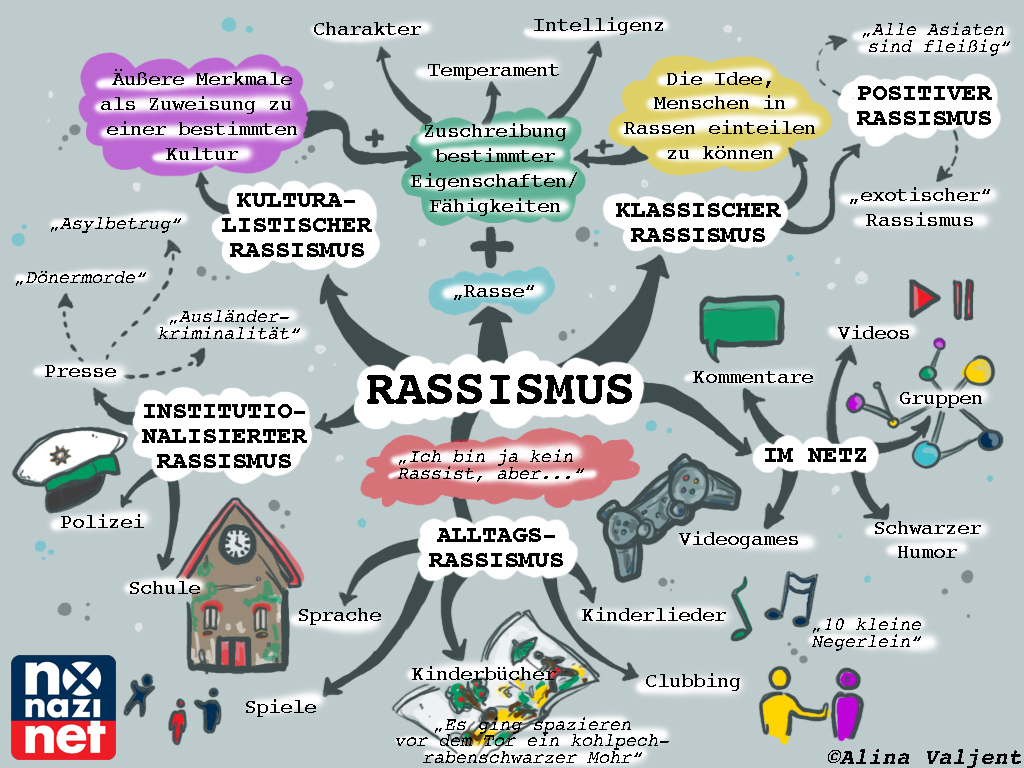
Was daran ist so schwierig?
Das ist so schwierig, weil es immer einfach ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Gerade Europa hat die Neigung zu sagen: „In dem und dem Land kriegen sie es nicht hin und Land XY ist homophob und wir sind es nicht… .“
Bei den Organisationen ist es ähnlich. Selbst im linken Sektor, wo Leute den Anspruch haben, für Gerechtigkeit zu kämpfen und Ungleichheiten beseitigen zu wollen, ist es gang und gäbe, dass genau die gleichen Machtstrukturen, die in der Mehrheitsgesellschaft stattfinden, reproduziert werden.
Es gibt unendlich viele antirassistische Organisationen, die mehrheitlich weiß sind
Einen Anspruch zu haben, ist aber kein Schutzmantel, denn: Attitude und Verhalten sind unkorreliert. Auf gut Deutsch: Was Leute denken, hat nichts damit zu tun, wie sie sich verhalten.
Das spiegelt sich dann zum Beispiel bei der Einstellungspolitik wider. Es gibt unendlich viele antirassistische Organisationen, die mehrheitlich weiß sind. Werden die Leute gefragt, wie das sein kann, werden sie meist nicht sagen, dass sie ausländische Menschen blöd finden, sondern dass es mit Soundso besser gepasst hat.
Aber das ist aber genau der Punkt, an dem alle NGOs inklusive der Aidshilfen feststellen sollten: „Moment mal, das kann kein Zufall sein!“ Genauso wie es kein Zufall sein kann, dass fast alle Psychologie-Professuren durch Männer besetzt sind.
Wie können Organisationen wie die Aidshilfen solche unbewussten Mechanismen reflektieren und wie kann struktureller Rassismus abgebaut werden?
Einer der wichtigsten Ratschläge, den ich da mitgeben kann, ist: Es geht nicht darum, sich zu profilieren, gut auszusehen. Es gibt immer wieder Leute, die denken, dass es ausreicht, zum Beispiel ein bis zwei nichtweiße Menschen einzustellen, die dann bitte auch bei jedem Betriebsfoto in der ersten Reihe stehen. Das ist eine gängige Strategie von Universitäten bis hin zu kommerziellen Betrieben. Aber das reicht nicht.
Wenn wir zum Beispiel Kampagnen entwickeln möchten, sagen wir mal für Männer, die mit Männern Sex haben und nicht weiß sind, dann reicht es nicht, Leute aus dem Netzwerk anzuschreiben und zu sagen: „Gebt uns mal eure Ideen!“
Es reicht nicht, nur ein bis zwei nichtweiße Menschen einzustellen
In kapitalistischen Gesellschaften arbeitet kein Mensch unbezahlt, denn sonst überleben wir nicht.
Das wäre also genau der Punkt, wo man sagen könnte: „Gut, dann suchen wir mal nach einem Pädagogen oder einer Psychologin oder einem anderen geeigneten Menschen, der sowohl die fachliche Kompetenz hat als auch die Erfahrung der Lebensrealität, um adäquate Maßnahmen zu entwickeln!“
Andernfalls passiert das, was in den letzten zehn, zwanzig Jahren zu häufig passiert ist: Leute, die keine Ahnung haben von bestimmten Lebensrealitäten und mit sehr vielen Vorurteilen beladen an die Gruppe herangehen, entwerfen Interventionen, die nichts und wieder nichts bringen. Das ist nicht nur Geld-, sondern auch Zeitverschwendung.
Reicht es denn aus, nur einzelne Expert_innen zu beschäftigen?
Nein. Die Erfahrung zeigt, dass heterogene Gruppe die besten Resultate bringen, egal in welcher Hinsicht, auch wenn es natürlich bedeutend schwieriger ist, sich mit einer vielfältigen Gruppe zu einigen.
Aber wenn ihr das macht, könnt ihr sicher sein, dass eure Interviews, eure Kampagnen bedeutend besser sind, weil ihr zumindest mehrere Perspektiven habt.
Parallelen ziehen zu eigenen Diskriminierungserfahrungen ist ein guter Ansatz, um einzusteigen, aber die Vielfältigkeit von Lebensrealitäten ist dadurch nicht ersetzbar.
Ein kleines Beispiel: Als ein Kollege hörte, dass eine Dragqueen nach einer Party im Bus verprügelt worden war, sagte er: „Ist die blöd? Warum nimmt die nicht einfach ein Taxi?“
Er war Akademiker und hat nicht mal daran gedacht, dass Taxen für ganz viele Leute absolut keine Option sind. War der Mann blöd? Nein, er war Akademiker. Dumm war er nicht. Aber seine Lebensrealität war so weit weg, dass er das nicht sehen konnte.
Wie wichtig sind geschützte Räume?
Schutzräume sind extrem wichtig, auch wenn wir oft mit Widerstand, der Angst vor Ausschluss und Sich-bedroht-Fühlen arbeiten müssen, wenn diese entstehen.
Doch das ist es wert, denn allein dieser Austausch kann unglaublich empowernd sein und sehr viel Kraft geben, weil Menschen plötzlich wissen, ich bin nicht alleine, ich bin nicht die einzige Person, die an dem Abend weggeschickt worden ist, ich bin nicht die einzige, die vom Kontrolleur angefahren worden ist, obwohl ich ein Ticket hatte.
Explizite Schutzräume für nichtweiße People of Color sind eine Notwendigkeit
Zum anderen können Leute so auch gemeinsam Strategien entwickeln, wie du damit umgehst oder wie du kontern kannst.
Explizite Räume für nichtweiße Menschen of Color sind keine Bedrohung, sondern eine Notwendigkeit, die nicht notwendig wäre, wenn es keinen strukturellen Rassismus gäbe.
Solange es den gibt, brauchen wir die Räume. Und wenn wir Glück haben, entstehen aus den Schutzräumen irgendwann schöne gemischte und vor allem sicherere Räume für alle.
Einstellungspolitik, die Einbeziehung der Communitys, die Einrichtung von Schutzräumen, das sind alles strukturelle Herangehensweisen. Wie sieht es mit dem Rassismus in uns selbst aus? Wie können wir Menschen für eine rassismuskritische Auseinandersetzung gewinnen, ohne sie abzuschrecken oder Widerstand zu erzeugen?
Ich habe mehrere konkrete Tipps. Erstens: keine Zweiteilung. Die allermeisten Leute denken, du bist entweder rassistisch oder nicht. Das sind die Guten und das sind die Schlechten.
Wenn du den Leuten diese Handhabung anbietest, werden 99,9 Prozent der Menschen sagen: „Ich bin ein guter Mensch und somit nicht rassistisch.“ Problem gelöst.
Doch wenn das stimmen würde, dann gäbe es keinen Rassismus mehr.
Wir müssen uns also von der vereinfachenden Sicht verabschieden, dass gute Menschen nicht rassistisch sein können und nur schlechte Menschen, die in der Minderheit sind, rassistisch sind – irgendwelche Neonazis zum Beispiel.
Auch „gute“ Menschen können rassistisch sein
Zweitens: Wie vorhin erwähnt sind Attitude und Verhalten unkorreliert. Das heißt: Die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten ist eine der wichtigsten Grundlagen, um antirassistisch tätig zu sein.
Es geht darum, verinnerlichten Rassismen auf die Schliche zu kommen, denn diese fallen irgendwann auf, wenn die Reflektion der eigenen Räume nicht stattgefunden hat.
Menschen, die sagen, „Ich habe alle Formen von Diskriminierung reflektiert, verstanden und abgebaut!“, finde ich immer extrem unglaubwürdig. Bei den Leuten, die am lautesten schreien, bin ich skeptisch.
Ich finde es wichtig, in den eigenen Kreisen zu beginnen, zum Beispiel im Familienkontext. Ich kenne sehr viele Leute, die in ihren Großstädten, in ihren politisierten Subkulturen große Töne spucken über Sprachgebrauch, welche Witze okay sind und welche nicht, und die gleichen Leute schlucken die gleichen Witze, wenn sie Weihnachten zu Onkel Gerhard fahren, wo es Gänsebraten gibt. Denn Onkel Gerhard ist halt so.
Fangt bei Onkel Gerhard an!
Bitte! Fangt genau bei Onkel Gerhard an. Oder bei Menschen an eurem Arbeitsplatz. Denn wenn antirassistische Arbeit bequem und einfach wäre, würde ich heute kein Interview zum 21. März geben.
Ähnlich verhält es sich bei persönlichen Beziehungen. Wenn ich in meinem gesamten Leben noch nie mit einer Person befreundet oder zusammen war, die Rassismus erfährt, dann habe ich wenig Ahnung davon. Dann kenne ich bestimmte Sachen nicht und kann sie nicht kennen.
Aufrichtige emotionale Bindungen aber schaffen Verbundenheit und Solidarität. Und das führt dazu, dass es immer mehr Menschen gibt, die sensibilisiert sind. Das heißt: Wir können einen Teil der Ängste und einen Teil der Vorurteile beiseitelegen, weil wir die komplexen Lebensrealitäten von den Menschen mit den wir zu tun haben besser kennen als vorher.
Was ist dein Wunsch zum Internationalen Tag gegen Rassismus?
Dass so ein Tag irgendwann nicht mehr nötig sein wird und dass Leute sich nicht nur am 21. März mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ich finde es schön, Tage zu haben, an denen Bewusstsein für bestimmte Sachen geschaffen wird. Aber antirassistische Arbeit muss 365 Tage im Jahr passieren. Sonst wird die Gerechtigkeit, die wir so dringend brauchen, sehr lange auf sich warten lassen.
Vielen Dank, Pum!
Interview: Senami Zodehougan

Dr. Pum Kommattam ist Psychologe und forscht unter anderem zu interkultureller Emotionswahrnehmung und Intersektionalität in vermeintlich sicheren Räumen. Er arbeitet als psychologischer Berater in der psychosozialen Beratungsstelle Lesbenberatung Berlin e.V. und ihrem Antidiskriminierungs- und Antigewalt-Bereich LesMigraS und befindet sich in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten am Zentrum für Psychotherapie der Humboldt-Universität zu Berlin.
Diesen Beitrag teilen




