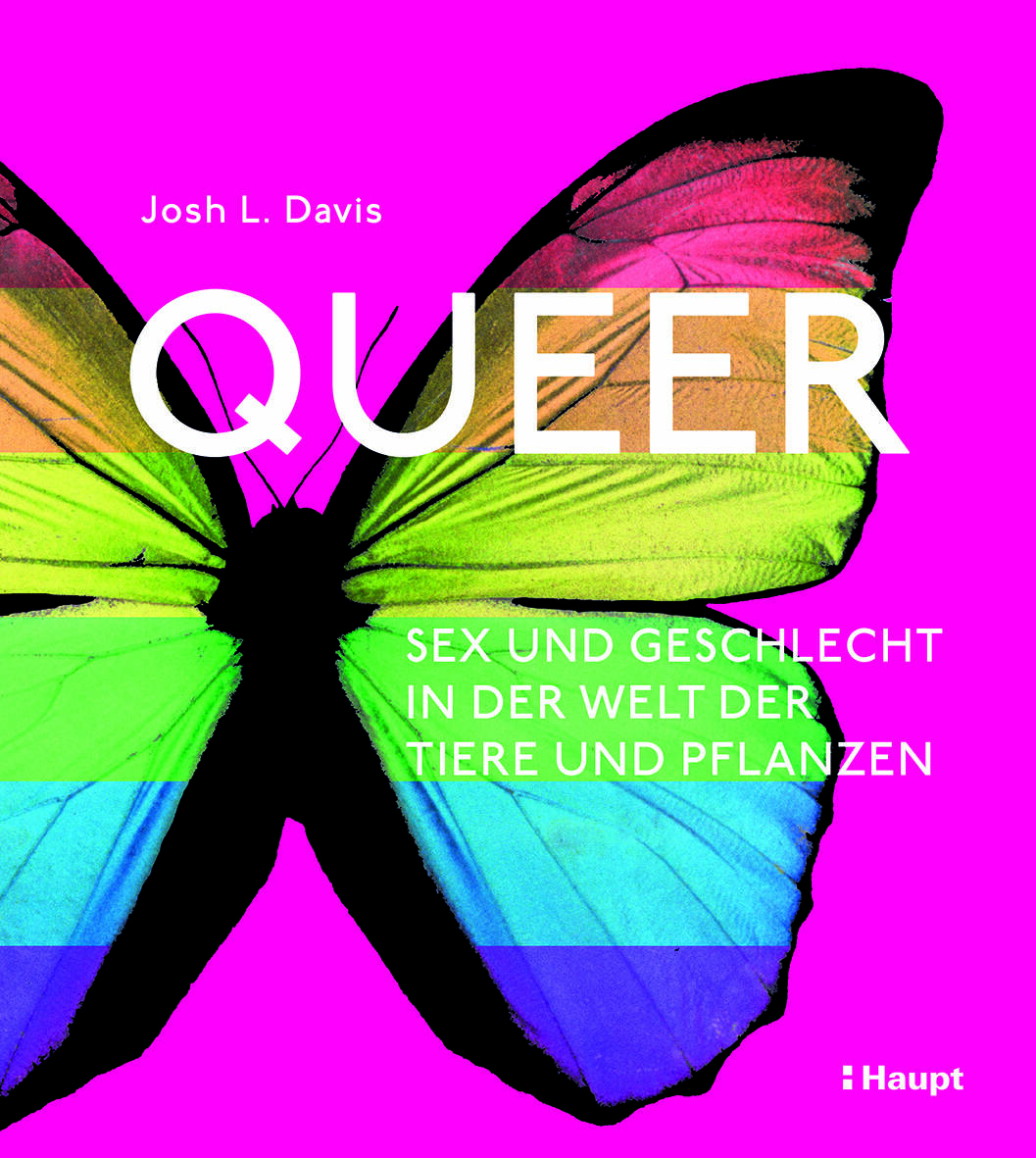Die unglaubliche Vielfalt nicht-heteronormativer Biologie

Wenn Giraffen, Schwäne und Pinguine die Norm sprengen: Queere Sexualität und Geschlechtervielfalt sind keine rein menschlichen Phänomene, sondern in der Natur weiter verbreitet, als man vermuten würde. Das eindrucksvolle Buch „Queer – Sex und Geschlecht in der Welt der Tiere und Pflanzen“ zeigt Queerness nicht als Abweichung, sondern als biologisches Prinzip.
Hausschafe und Webspinnen tun es, Humboldt-Kalmare und Schwarzschwäne ebenso wie Längsbandkärpflinge und Feldmaikäfer. Bei dieses und mehr als 1.500 weiteren Tierarten wurde gleichgeschlechtliches Verhalten beobachtet. Das ist freilich keine neue Erkenntnis. Immer wieder werden etwa männliche Pinguin-Paare zu Stars in zoologischen Gärten, weil sie gemeinsam Eier ausbrüten und sich als fürsorgliche Eltern erweisen. Für alle jene aber, die Homosexualität, Geschlechtervielfalt und diverse Formen von Sexualität als „unnatürlich“ und als Abweichung von der Norm halten, könnte dieser erhellende Band das Weltbild erschüttern. Denn „Queer – Sex und Geschlecht in der Welt der Tiere und Pflanzen“ zeigt, dass es in Sachen Geschlechtsidentität und sexuellem Verhalten in Flora und Fauna so bunt und vielfältig zugeht, dass Menschen im Vergleich dazu farblos erscheinen.
Als Rechtfertigungsschrift für Queerness – ganz gleich ob bei Tieren, Menschen oder Pflanzen – aber will der britische Wissenschaftsautor Josh L. Davis, der für das Natural History Museum in London arbeitet, sein Buch nicht verstanden wissen. Denn dafür bedürfe es keiner Rechtfertigung. Auch will er die Welt der Tiere und Pflanzen nicht mit der Welt der Menschen in direkten Vergleich setzen. Ihm geht es in erster Linie darum, die „schier unglaubliche Vielfalt von nicht-heteronormativer Biologie und Verhalten aufzuzeigen, die in der Natur existieren – Verhalten, das nicht auf der angenommenen Binarität ‚traditioneller‘ männlicher und weiblicher Rollen basiert“. In 30 eindrucksvoll bebilderten Kapiteln entfaltet Josh L. Davis mit bemerkenswerten Beispielen, was sich die Natur in Sachen Sex, Geschlecht und Fortpflanzung so alles einfallen lässt und wofür unsere gängigen Begriffe wie Intergeschlechtlichkeit, sexuelle Fluidität und Transition nur ansatzweise reichen.
Vorurteile der Wissenschaft
Gleich am ersten Beispiel macht Davis deutlich, wie stark die Wissenschaft von Vorurteilen geprägt ist, sodass entsprechende Erkenntnisse kleingeredet oder gar bewusst verschwiegen wurden. Schon während einer Antarktis-Expedition von 1910 bis 1913 hatte der britische Arzt George Murray Levick gleichgeschlechtliches Verhalten unter Adeliepinguinen beobachtet. Levick bezeichnete diese Exemplare als „Hooligans“. Sein Buch „Natural History of the Adélie Penguin“ erschien 1915 jedoch ohne das entsprechende Kapitel – die vollständige Ausgabe erschien lediglich als Privatdruck mit 100 Exemplaren.
Erst ein Jahrhundert später wurden diese Aufzeichnungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute sind schwule Pinguinpaare fast schon zu Symbolfiguren geworden. In Chester sorgten unlängst Scampi und Flounder für internationale Schlagzeilen, als sie gemeinsam zwei Eier ausbrüteten und den Nachwuchs aufzogen – ein Bild von Fürsorge und Stabilität, das mit dem Klischee vom „unnatürlichen“ gleichgeschlechtlichen Verhalten bricht.
Auch bei Schwänen haben Ornithologen wiederholt beobachtet, dass zwei Männchen nicht nur eine Bindung eingehen, sondern gemeinsam Nester bauen, Eier von Weibchen übernehmen und die Jungen großziehen. Überraschenderweise haben diese Paare oft größere Bruterfolge als heterosexuelle Paare. Ein Grund dafür könnte sein, dass zwei Männchen ihr Territorium energischer verteidigen und so mehr Sicherheit für die Aufzucht schaffen.
Soziale Bindungen durch Sex
Noch spektakulärer wirken die Zahlen bei Giraffen. In manchen Populationen sind bis zu 94 Prozent aller sexuellen Kontakte zwischen Männchen – also nahezu das gesamte sichtbare Paarungsverhalten. Sie beschnuppern sich, reiben die Hälse aneinander, reiten auf und verbringen Stunden in inniger Zuwendung. Lange versuchten Biologen, dieses Verhalten als „Spiel“ oder „Dominanzritual“ zu beschreiben. Erst in den letzten Jahren setzte sich die Erkenntnis durch: Auch hier handelt es sich schlicht um gleichgeschlechtliche Sexualität.
Ähnliches gilt für Schafe. Viehzüchter wissen seit Jahrhunderten, dass es Böcke gibt, die keinerlei Interesse an Weibchen zeigen und ihr Leben lang nur andere Männchen besteigen. Bei Wildschafen bilden sich bisweilen homosexuelle Gemeinschaften, sodass brünstige Schafe Schwierigkeiten haben können, begattet zu werden. Weibchen ahmen daher bisweilen männliches Verhalten nach, um die Schafböcke zu täuschen. Andererseits nehmen Böcke weibliches Verhalten an, um von ihren Geschlechtsgenossen nicht sexuell belästigt zu werden.
Besonders gut erforscht ist das Verhalten von Gorillas, Bonobos und anderen Affenarten. Auch sie nutzen Sexualität nicht allein zur Fortpflanzung, sondern zur sozialen Bindung. Bei Bonobos, oft als „Hippies unter den Primaten“ bezeichnet, gehört gleichgeschlechtlicher Sex selbstverständlich zum Alltag. Weibchen reiben ihre Genitalien aneinander, Männchen praktizieren Fellatio oder gegenseitige Masturbation. Das dient nicht nur der Lust und Nähe, sondern ist auch eine Form der Konfliktlösung – Streitigkeiten werden „weggevögelt“.
Fließende Geschlechtergrenzen
Doch Davis’ Buch zeigt nicht nur Beispiele für gleichgeschlechtliche Sexualität, sondern auch, wie fließend das Konzept „Geschlecht“ in der Natur sein kann. Bei Fasanen kommt es vor, dass weibliche Fasane das prächtige Federkleid eines Hahns annehmen, und umgekehrt männliche Exemplare das schlichte Gefieder der Hennen. Manche Papageienfische schlüpfen als Weibchen und verwandeln sich später in Männchen. Meeresschildkröten wiederum entwickeln ihr Geschlecht abhängig von der Bruttemperatur: Unter 29 Grad entstehen Männchen, bei höheren Temperaturen Weibchen. Der Klimawandel bringt das Geschlechterverhältnis bereits heute massiv ins Wanken. Der unscheinbare Mangroven-Killifisch ist sogar in der Lage, sich selbst zu befruchten, weil er sowohl Spermien als auch Eier produziert. Und eine kleine Echsenart in New Mexico besteht ausschließlich aus Weibchen, die dennoch Sex miteinander haben, bevor sie unbefruchtete Eier legen – offenbar, um den Eisprung anzuregen. Auch Pflanzen und Pilze erweitern unser Bild von Geschlecht. Der Spaltblättling, ein unscheinbarer Baumpilz, kennt nicht zwei, nicht drei, sondern über 23.000 Paarungstypen – eine biologische Realität, die unsere Vorstellung von „männlich“ und „weiblich“ sprengt.
Dass all diese Beobachtungen lange Zeit nicht ernst genommen oder sogar verschwiegen wurden, hat mit den Vorurteilen der Wissenschaft selbst zu tun. Begriffe wie „Pseudokopulation“ oder „Fehlverhalten“ dienten dazu, gleichgeschlechtliches Verhalten als Abweichung zu stigmatisieren. Davis zeigt, wie sehr diese Sprache von gesellschaftlichen Moralvorstellungen geprägt war. Sein Buch ist deshalb nicht nur eine Sammlung kurioser Tiergeschichten, sondern ein Plädoyer, Sexualität und Geschlecht in all ihrer Vielfalt als normal zu begreifen. Queerness, so die Botschaft, ist kein Sonderfall der Natur – sie ist ihr Prinzip.
Josh L. Davis: „Queer. Sex und Geschlecht in der Welt der Tiere und Pflanzen“. Aus dem Englischen von Monika Niehaus. Haupt Verlag, Bern 2025, 128 Seiten, 19 Euro.
Mehr Buchtipps
Diesen Beitrag teilen