Verpasste Chancen und späte Diagnosen
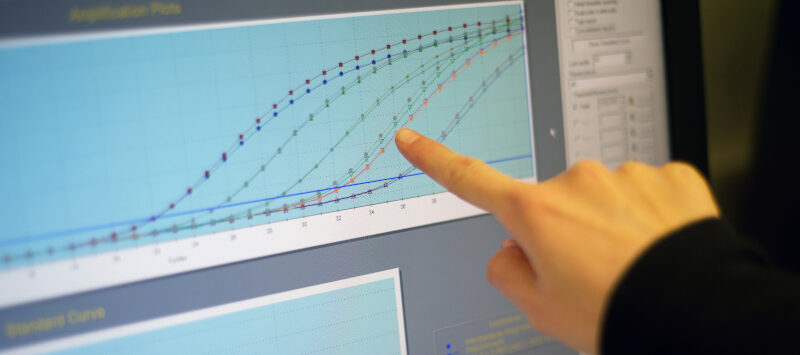
Etwa ein Drittel der HIV-Neudiagnosen wird erst gestellt, wenn bereits ein schwerer Immundefekt vorliegt. Frauen sind von solchen Spätdiagnosen häufiger betroffen. Die Epidemiologin Annemarie Pantke vom Robert Koch-Institut untersucht, inwieweit soziale Verhältnisse dafür ursächlich sind.
Annemarie Pantke, Ihre Studie widmet sich der Frage, inwieweit die sozialen Verhältnisse, Bildung oder das Stadt-Land-Gefälle Einfluss auf den Zeitpunkt einer HIV-Diagnosestellung haben können. Sie benutzen dafür den Begriff der sozioökonomischen Ungleichheiten beziehungsweise Deprivation. Was versteht man darunter?
Wir haben für unsere Studie den am Robert Koch-Institut entwickelten German Index of Socioeconomic Deprivation genutzt, der auf drei Dimensionen basiert: dem Berufs-, Bildungs- und Einkommensstatus. Dazu wurden für alle kreisfreien Städte und Landkreise beispielsweise die Arbeitslosenquote oder der mittlere Bruttolohn herangezogen. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen: Eine hohe regionale sozioökonomische Deprivation bedeutet, dass Personen, die in dieser Region leben, im Schnitt einen niedrigen sozioökonomischen Status haben und in sozial schwächeren Verhältnissen leben.
Studien aus den USA zeigen, dass Menschen mit geringen sozioökonomischen Ressourcen ein höheres HIV-Risiko haben
Wie können sich solche Faktoren tatsächlich auf die Gesundheit einzelner Personen auswirken?
Wir wissen aus der Gesundheitsforschung bereits, dass ein niedriger sozioökonomischer Status mit schlechteren gesundheitlichen Outcomes einhergeht, wie zum Beispiel einem höheren Risiko für Grunderkrankungen oder auch einer niedrigeren Lebenserwartung. Im Hinblick auf HIV und Aids gibt es Studien dazu vor allem aus den USA, die zeigen, dass Menschen mit geringen sozioökonomischen Ressourcen ein höheres HIV-Risiko wie auch ein höheres Sterblichkeitsrisiko haben. Da es für Deutschland solche Untersuchungen noch nicht gab, haben wir diese Studie durchgeführt und den Fokus auf HIV-Spätdiagnosen gelegt.
Welche Daten konnten Sie für Ihre Studie auswerten?
Wir haben uns die gesetzlichen Meldedaten der HIV-Diagnosen aus den Jahren 2011 bis 2018 angesehen. Für rund 10.000 dieser HIV-Neudiagnosen lagen uns Angaben zum Zeitpunkt der Diagnose beziehungsweise zum Aids-Status vor. Rund 13 Prozent aller Neudiagnosen, die wir analysiert haben, wurden erst im Aids-Stadium diagnostiziert. Diese Meldedaten haben wir anhand der Postleitzahlen mit dem German Index of Socioeconomic Deprivation verknüpft.
Sie haben in Ihrer Untersuchung drei Hauptgruppen herausgestellt: Männer, die Sex mit Männern haben – kurz: MSM –, Menschen mit heterosexuellen Sexualkontakten und Drogengebrauchende. Wie unterscheiden sich diese Gruppen bei der Häufigkeit von Spätdiagnosen?
Wir konnten sehen, dass der Anteil von länger bestehenden Infektionen wie auch der von Aids-Erkrankungen zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bei Personen mit heterosexuellem Übertragungsweg signifikant höher war als bei den beiden anderen Hauptgruppen. In absoluten Zahlen jedoch finden die meisten Spätdiagnosen bei MSM statt, also bei Männern, die Sex mit Männern haben.
Wie groß ist der Anteil der Frauen unter den HIV-Spätdiagnosen bei Heterosexuellen?
Aktuell gehen rund ein Viertel aller HIV-Neudiagnosen auf Personen mit heterosexuellem Übertragungsweg zurück, wobei Frauen den größeren Teil ausmachen. Bei den Frauen haben etwa 75 Prozent ihre Diagnose nach der rezenten Phase – etwa fünf bis sechs Monate nach Ansteckung – in länger bestehenden Stadien erhalten und 15 Prozent wurden erst im Aids-Stadium diagnostiziert.
Gibt es Unterschiede zwischen in Deutschland aufgewachsenen und zugewanderten Heterosexuellen oder zwischen den Infektionen, die in oder außerhalb Deutschlands erfolgten?
Sowohl bei den heterosexuellen Migrant*innen aus Hochprävalenzländern als auch bei den Heterosexuellen aus Deutschland oder dem europäischen Raum kommt es zu vielen Spätdiagnosen. Bei der ersten Gruppe, weil zum Beispiel aus Angst vor Stigmatisierung oder aus Sorge davor, bei einer HIV-Infektion abgeschoben zu werden, kein Test gemacht wird. Das sehen wir vor allem bei Frauen aus Subsahara-Afrika und Südostasien.
Bei den Heterosexuellen aus Deutschland oder dem europäischen Raum gehören neben der Angst vor Stigmatisierung und Ausgrenzung auch ein generell niedriges Risikobewusstsein für HIV und fehlendes Wissen über die Erkrankung zu den Gründen. Das ist allerdings nicht nur auf Seiten der Patient*innen, sondern auch der Ärzt*innenschaft im Hinblick auf diese heterosexuelle Gruppe zu beobachten.
Haben die soziökonomischen Faktoren bei Heterosexuellen dann überhaupt einen Einfluss auf den Zeitpunkt der Diagnose, insbesondere bei Frauen?
Wir konnten in unserer Studie sehen, dass sozioökonomische Faktoren bei Heterosexuellen, insbesondere bei Frauen, keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Diagnose hatten. Bei ihnen scheint die Angst vor Stigmatisierung beziehungsweise das fehlende Risikobewusstsein schwerer zu wiegen und ist in allen sozialen Schichten vorhanden. Wir wissen aus anderen Studien, dass eine wichtige Rolle dabei auch die sogenannten „missed opportunities“ spielen, die verpassten Chancen, wenn von Ärzt*innen bestimmte Symptome nicht als HIV anzeigende Erkrankung erkannt werden. Wenn etwa eine 50-jährige verheiratete Frau mit einer Lungenentzündung vorstellig wird, wird an eine mögliche HIV-Infektion eben nicht gedacht.
Bei MSM spielen sozioökonomische Faktoren eine erkennbare Rolle
Bei MSM hat die sozioökonomische Deprivation hingegen Auswirkungen auf den Anteil später Diagnosen. Wie ist das zu erklären?
Der Anteil der Spätdiagnosen ist bei den MSM zwar niedriger, bei diesen spielen die soziökonomischen Faktoren dann jedoch eine erkennbare Rolle. Vor allem MSM in ländlichen Regionen mit hoher soziökonomischer Deprivation hatten ein höheres Risiko, erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert zu werden.
Eine Erklärung dafür könnte sein, dass bei den HIV-Präventionskampagnen und Teststrategien in Deutschland traditionell ein stärkerer Fokus auf MSM gelegt wird, was dazu geführt hat, dass in dieser Gruppe das Wissen und das Bewusstsein für HIV und die Infektionsrisiken viel höher ist im Vergleich zu Heterosexuellen. Geringere sozioökonomische Ressourcen wirken sich bei ihnen somit auf die gesundheitlichen Outcomes bei HIV aus.
Allerdings schlägt sich die soziale Deprivation nur bei Spätdiagnosen von MSM im ländlichen Bereich nieder und nicht in den größeren Städten. Wahrscheinlich, weil es dort bessere Strukturen wie etwa Testmöglichkeiten und HIV-Schwerpunktpraxen gibt. Aber auch, weil die Community stärker vernetzt ist. Solche Strukturen in den Städten können die soziökonomische Deprivation erkennbar besser abfangen.
Drogengebrauchende sind ja grundsätzlich sozial wie ökonomisch in einer benachteiligen Situation. Zugleich gibt es, zumindest in größeren Städten, eine ähnlich gute Hilfeinfrastruktur wie für MSM. Wie zeigt sich das in Ihrer Untersuchung?
Wir haben die Drogengebrauchenden nicht explizit untersucht, da diese nur einen kleinen Anteil der Neudiagnosen ausmachen. Die Zahlen sind in den letzten Jahren und insbesondere 2020 bei den weiblichen Drogengebrauchenden aber angestiegen, wofür es jedoch noch keine evidenzbasierte Erklärung gibt. Der Anteil der Spätdiagnosen bei Drogengebrauchenden liegt allerdings niedriger als bei Personen mit heterosexuellem Übertragungsweg und ist vergleichbar mit jenem bei MSM.
In einer Kohortenstudie hatten Drogengebrauchende das höchste Risiko, eine Aids-Erkrankung zu entwickeln
Wir führen aktuell auch eine Kohortenstudie zu den Aids-Erkrankungen im Zeitalter der antiretroviralen Therapie durch. Wir schauen uns hier alle Aids-Erkrankungen seit 1999 bis heute an und können sehen, dass Drogengebrauchende anders als alle anderen Gruppen das höchste Risiko hatten, Aids-Erkrankungen zu entwickeln – und zwar unabhängig davon, in welchem Stadium sie diagnostiziert wurden. Das lässt sich wahrscheinlich einfach auf die Lebensumstände zurückführen, durch den der regelmäßige Kontakt zu Ärzt*innen und die kontinuierliche Einnahme der Medikamente erschwert wird. Auch der allgemein schlechtere Gesundheitszustand spielt hier sicherlich eine Rolle.
Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus den Studienergebnissen ableiten? Was muss getan werden, damit HIV-Infektionen in den drei Kerngruppen früher diagnostiziert werden?
Die Studie hat uns gezeigt, dass die größte Herausforderung im deutschen Kontext im Hinblick auf HIV weiterhin bleibt, Spätdiagnosen zu reduzieren und damit auch eine potentielle Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Das ist die wohl wichtigste Baustelle auf dem Weg zum Ziel „Aids beenden“ . Aus unseren Ergebnissen konnten wir ableiten, dass ein differenzierter Ansatz für diese drei Kerngruppen gebraucht wird.
Auch Frauenärzt*innen sollten eine besondere Rolle einnehmen
Für die heterosexuelle Transmissionsgruppe deutscher Herkunft etwa kann man sagen, dass weiterhin eine Steigerung der Bewusstmachung wichtig ist, vor allem auch auf Seiten der Ärzteschaft, damit es zu weniger „verpassten Chancen“ kommt. Hier sollten auch Frauenärzt*innen eine besondere Rolle einnehmen, eben aufgrund des hohen Anteils an Frauen innerhalb der heterosexuellen Transmissionsgruppe.
Für die heterosexuelle Gruppe aus Hochprävalenzländern lässt sich empfehlen, dass weiterhin eine Reduzierung der Angst vor Stigmatisierung eine Rolle spielt. Wichtig sind auch niedrigschwellige Testangebote. Außerdem könnte sich eine Zusammenarbeit mit Mitgliedern aus der Community nützlich erweisen.
Bei den MSM lohnt es sich auf jeden Fall, die sozialen Ungleichheiten zu beachten und einen Fokus auf ländliche Regionen mit schlechteren sozialen Bedingungen zu legen und dort etwa den Aufbau von HIV-Schwerpunktpraxen oder auch Checkpoints zu fördern. Aber auch eine bessere Vernetzung von MSM in diesen Regionen wäre sinnvoll.
Bei Drogengebraucher*innen sollten weiterhin die communitybasierte Arbeit, Prävention und niedrigschwellige Testangebote wie auch der Zugang zu Behandlung und antiretroviraler Therapie unterstützt werden.
Vielen Dank für das Gespräch!
Weitere Beiträge zum Thema:
Diesen Beitrag teilen




